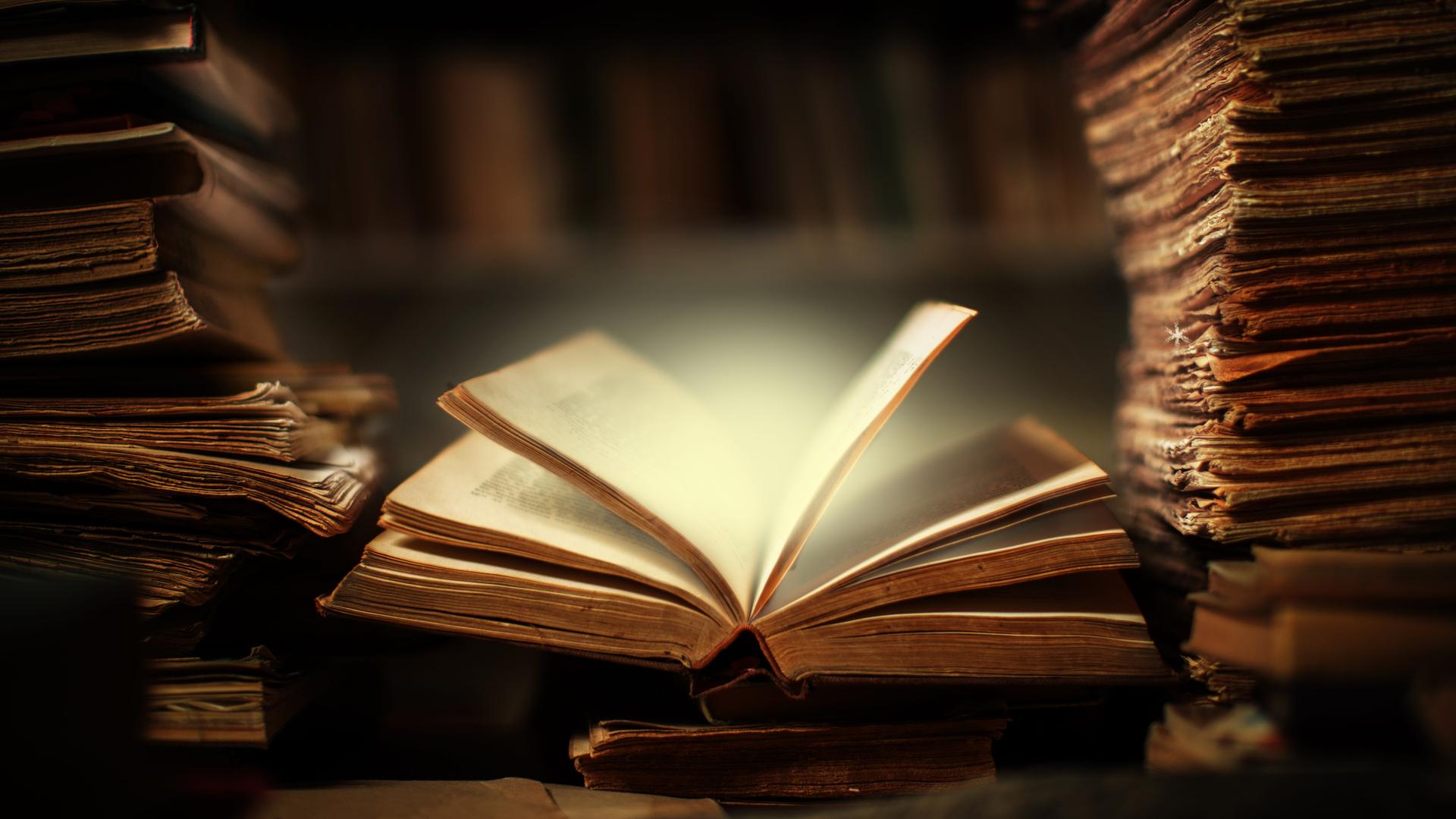Müllberge, E-Scooter-Chaos - unsere Städte sind oft geprägt durch Anzeichnen von Verwahrlosung. Die achtlos auf den Bürgersteig geworfene Alufolie mag unbedeutend wirken - doch sie verweist auf ein tieferes Problem: eine Freiheit, die sich im Rückzug aufs bloße Ich erschöpft. Libertär gedacht bedeutet sie vor allem, von anderen unbehelligt zu bleiben. Diese Haltung prägt das Stadtbild: Überquellende Papierkörbe, verwilderte Grünstreifen, Matratzen auf Bürgersteigen, ein öffentlicher Raum, der als Niemandsland behandelt wird. Politische Philosophie kennt dafür einen Gegenentwurf: den Republikanismus.
Er begreift Freiheit nicht primär als Abwehrrecht, sondern als Fähigkeit zur Mitgestaltung. Hier entsteht Öffentlichkeit nicht durch Verbote, sondern durch das geteilte Interesse am Gemeinsamen. Ein „ästhetischer Republikanismus“ verschiebt den Fokus: Er fragt, ob Straßen, Plätze, Nachbarschaften nicht nur funktional, sondern auch schön sind - als sichtbarer Ausdruck einer geteilten Verantwortung. Schönheit wird so zur politischen Kategorie: Sie fordert Pflege, Takt, Rücksicht, kurzum ein Ethos des Miteinanders. Statt zwischen privater Willkür und kollektivistischer Bevormundung zu pendeln, eröffnet sich eine dritte Möglichkeit: die gemeinsame Gestaltung des Raums, den wir bewohnen. Die entscheidende Frage lautet dann nicht: Wer hebt den Müll auf? Sondern: Wie wollen wir leben - und wie soll es aussehen?
Arnd Pollmann, geboren 1970, ist Professor für Ethik und Sozialphilosophie an der Alice Salomon Hochschule Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Menschenrechts- und Würdeforschung, in Fragen politischer Philosophie sowie der Sozialethik. Zu seinen wichtigsten Publikationen zählt Menschenrechte und Menschenwürde. Zur philosophischen Bedeutung eines revolutionären Projekts (2022).
Neulich im sozialen Netzwerk X: Ein User ärgert sich über die neuen, fest verbundenen Plastikdeckel auf PET-Flaschen und Getränkekartons, die seit einer EU-Verordnung von 2024 die gedankenlose Müllentsorgung eindämmen sollen. Verbraucherinnen und Verbraucher beklagen, dass diese Deckel beim Trinken stören, in Augen und Nase zwicken; dass sie das kleckerfreie Eingießen behindern und auch nicht wieder richtig schließen. Der aufgebrachte User mit großer Reichweite spottet: „Ich halte Menschen, die diese Deckel nicht sofort abreißen und sich diese Bevormundung auch noch schön reden, für geborene Untertanen.“ Und prompt kontert jemand: „Ich halte Menschen einfach nur für dumm, die ein Problem haben, mit diesem Deckel zu trinken.“
Dieses kleine Wortgefecht ist symptomatisch für den politischen Diskurs unserer Tage. Man kann sehr wohl darüber streiten, wie sinnvoll diese Deckel sind, aber doch nicht so: Die eine Seite wischt das Problem fortschreitender Vermüllung einfach vom Tisch und denunziert den Gegner als autoritär unterwürfig. Die andere Seite wütet spiegelbildlich, stellt ihre moralische Überlegenheit ins Schaufenster und tut so, als sei dieser unbeliebte Deckel tatsächlich eine kluge Problemlösung. Statt also über die Sache selbst zu sprechen und über die Frage, wie wir das grassierende Müllproblem in den Griff bekommen, folgt man der ultimativen Streitempfehlung des Philosophen Arthur Schopenhauer: „Wenn man merkt, daß der Gegner überlegen ist und man Unrecht behalten wird, so werde man persönlich, beleidigend, grob.“
Sagen wir es mal so: Das ist nicht schön! Wer so miteinander redet, wähnt sich jeweils in einer anderen Welt. Und von dort schüttet man dann Gülle in die andere. Daraus ergibt sich eine doppelte Vermüllung: eine der physischen Umgebung durch Abfall und eine der Diskursarena durch vorsätzliches Unverständnis. Beide gehören sie zu einer „Verwahrlosung des öffentlichen Raums“, die im Folgenden etwas näher betrachtet werden soll. Zunächst in dem sehr handfesten Sinn eines Zerfalls von Innenstädten und Infrastrukturen. Doch dabei ist im Hinterkopf zu behalten, dass die zweite Verfallsdiagnose dazu gehört: Mit dem sachlichen Gegenstand des Streits geht die Orientierung an einer gemeinsamen Sache, an der res publica, und damit an der Republik selbst verloren. Und so auch das, was diese Republik ausmachen würde: die gemeinsam zu verantwortende Aufgabe, die geteilte Welt so zu gestalten, dass man sich darin gemeinsam wohlfühlen kann.
Lässt sich diese doppelte Vermüllung stoppen? Ich werde dies die Suche nach einer neuen Politik des ästhetischen Republikanismus nennen: Es geht dabei um Politik. Das ist die Auseinandersetzung um die Frage, wie wir zusammen leben und wie wir regiert werden wollen. Es geht um Republikanismus und damit um eine andere Form der Demokratie. Und es geht um Ästhetik, die „Lehre von der sinnlichen Wahrnehmung“, und hier speziell um eine Ästhetik des öffentlichen Raums. Sie verstünde den Akt demokratischer Selbstbestimmung physisch konkret als einen Prozess kunstvoller „Gestaltung“. Aber der Reihe nach. Beginnen wir mit dem Sinn von Politik.
Jüngst flog dem Kanzler eine fraglos stammtischartige Bemerkung um die Ohren. Friedrich Merz hatte behauptet, es gebe ein Problem mit dem „Stadtbild“. Da diese Bemerkung äußerst vage formuliert war, ersichtlich aber migrantischen Gruppen junger Männer in Fußgängerzonen, Stadtparks und an Bahnhöfen galt, durfte sich der Kanzler über heftigen Gegenwind nicht wundern. Tatsächlich ging es Merz ja weniger um das Stadtbild im ästhetischen Sinn als vielmehr um sein städtisches Menschenbild.
Aber auch in den empörten Gegenreaktionen wurden meist zwei Themen vermischt: Die Frage, wer sich warum in den Innenstädten aufhält und den öffentlichen Raum nutzt, ist von der Frage, ob dieser Raum zunehmend unbehaglich und hässlich verwahrlost wirkt, immer auch relativ unabhängig. Jedenfalls kann der besorgniserregende Zustand der City nicht pauschal den sich dort tummelnden Menschen in die Schuhe geschoben werden. Er ist immer auch oder gar primär Ausdruck kommunalen Politikversagens: verfallende Infrastruktur, finanzielle Unterversorgung, mangelnde Müllbeseitigung, unzureichende Kontrolle, Obdachlosigkeit, Drogen, Armut und leider auch: mangelnde Bildung.
Dennoch sollte man nicht schon ideologisch oder um diskriminierende Stereotype zu meiden, die gegenteilige Pauschalisierung vornehmen und bestreiten, dass es Probleme mit dem öffentlichen Raum gibt. Überquellende Papierkörbe, verwilderte Grünstreifen, verwaiste Ladengeschäfte, Drogenbesteck, öffentliches Urinieren, E-Roller-Wracks, beschmierte Hauswände und bisweilen leider auch präpotenter Vandalismus. Wer das übersieht, muss an einer Sehstörung leiden.
Der Psychologe Philip Zimbardo ließ 1969 ein altes Auto in der New Yorker Bronx abstellen – mit abgeschraubtem Nummernschild und offener Motorhaube. Bereits zehn Minuten später begannen erste Passanten mit dem Ausschlachten des Wagens. Bald waren alle brauchbaren Teile abmontiert. Nach wenigen Tagen war das restliche Wrack sinnlos demoliert. In den 1980ern wurde dann die stadtkriminologische Broken Windows-Theorie berühmt: Bereits kleine Anzeichen von Unordnung im öffentlichen Raum, zum Beispiel kaputte Fensterscheiben, signalisieren, dass dieser Raum unzureichend gepflegt und kontrolliert wird. Schnell gesellen sich dann weitere Unordnung und auch Kriminalität hinzu. Die soziologisch bahnbrechende Einsicht dieser Theorie war jedoch: Die Devianz ist weniger die Ursache als vielmehr das Resultat kommunalen Politikversagens.
Heute kommt hinzu, dass die Gesellschaft insgesamt ein gewaltiges Motivationsproblem zu haben scheint. Dieses Problem hat weder einen Migrationshintergrund, noch ist es Ausdruck einer besonderen Klassen- oder Generationenzugehörigkeit. Der achtlos auf den Gehweg geworfene Coffee‑to‑go-Becher mag singulär unbedeutend wirken, doch in seiner Anhäufung wird klar, dass viele Mitmenschen ein geradezu pathologisches Verhältnis zum öffentlichen Raum entwickelt haben. Dessen Verwahrlosung ist die Folge einer Erosion gemeinsam gelebter Verantwortung. Der öffentliche Raum wird zum Niemandsland; zu einem Ort wachsender Entfremdung und Entfernung; zu einem Ort, der nicht länger allen, sondern niemandem zu gehören scheint.
Der Bürgersteig ist kein Bürgersteig mehr, sondern Gratis-Nutzfläche. Er wird verbraucht und verschandelt, weil er keinen Wert besitzt. Der Platz in der City dient nicht länger der Begegnung mit dem Anderen oder der Rast, sondern der Durchreise. Und grillt jemand im Park, hinterlässt er diesen regelmäßig so, wie man den eigenen Garten niemals verlassen würde. Eine „Stadtpolitik“, die diesen Namen verdient hätte, wäre vor allem der Versuch einer gemeinsamen Rückeroberung; die Übernahme geteilter Verantwortung und die Weigerung, ständig nur abzuwarten, bis der Staat, die Stadtreinigung oder der Facility Manager kommt.
Doch woran hapert es? Es gibt zunächst einen klärungsbedürftigen Zusammenhang zwischen dieser Verwahrlosung und dem, was die Politische Philosophie die „libertäre“ Gesellschaftsauffassung nennt. Der Libertarismus pocht radikal auf Freiheit. Man will sich von Staat und Gesellschaft möglichst wenig sagen lassen. Zentral ist das Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Alles ist erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. Und diese Verbote und damit die Befugnisse des intervenierenden Staates sind auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.
Man könnte meinen, diese Mentalität sei recht speziell. Doch tatsächlich ist sie weit verbreitet: überlaute Bluetooth-Speaker, Telefonieren im Zug, Kaugummiflecken und Kippen auf dem Trottoir, Parken in der zweiten Reihe, Einkaufswagen, die vom Discounter-Parkplatz geschoben werden. Die Bereitschaft, die eigene, freiheitliche Moral für – irgendwie – doch wichtiger als geltende Regeln zu halten, zieht sich quer durch alle Schichten. Sie ist keine Spezialität von Querdenkern, einer bestimmten Partei oder Tageszeitung. Und wie gesagt: Sie weist auch keinen besonderen Migrations- oder Klassenhintergrund auf. Allenfalls eine geschlechtsspezifische Schlagseite.
Wie später noch deutlich werden soll, wird diese Weltsicht vor allem dann zum Problem, wenn libertäre Willkürfreiheit weder durch Bildung noch durch Taktgefühl eingehegt ist. Aber die beklagte Vermüllung – Pizza-Kartons, ausrangierte Kühlschränke, Urin – sind nicht einfach bloß trotziger „Punk“ oder Indizien schlechter Erziehung, sondern der stadtästhetische Ausdruck einer grassierenden Nicht-Identifikation mit dem geteilten Lebensraum; einer privatistisch reduzierten Willkürfreiheit. Einer Freiheit, die sich im Rückzug auf das bloße Ich erschöpft. Wenn man eh schon widerwillig Steuern zahlt, will man sich nicht um den Müll kümmern müssen. Der E-Roller steht mitten auf dem Gehweg. Der Hund kackt auf die Baumscheibe. Man läuft wochenlang durch dunkle Hausflure, statt die Glühbirne einfach selbst zu tauschen. So weit ist es mit der vielgepriesenen Eigenverantwortung im libertären Weltbild dann doch auch wieder nicht bestellt. Sie findet ihre Grenze meist dort, wo das Ich für andere mitdenken müsste.
Ein Bestseller des populären Libertarismus titelt: „Freiheit beginnt beim Ich“. Da ist was dran, aber wenn die Freiheit dort auch endet, dann sieht es im Kiez eben so aus, wie es aussieht. Mit der Absage jenes Ichs an ein orientierendes Wir droht auch die Sorge um den geteilten Lebensraum verloren zu gehen. Wer sich den Staat als Nachtwächter wünscht und die Gemeinschaft als Zumutung empfindet, wird wenig Lust verspüren, mehr zu geben als notwendig. Kein Wunder, dass Libertäre erhebliche Schwierigkeiten mit einem sozialen Dienstjahr oder der Wehrpflicht haben.
Doch der kurze Streit um den Plastikdeckel hat bereits gezeigt: Reflexhaft ruft dieser Egozentrismus eine neue Verbotskultur auf den Plan. Sie hält libertäre Freiheitsfanatiker schlicht für unterbelichtet. Appelle an Gemeinsinn nützen nichts. Es müssen Verbote her: Plastiktüten, Einweggeschirr, Strohhalme, Versandhausretouren, E-Scooter, Laubbläser, Inlandsflüge und einmal im Jahr: Böller. All diese Konsumgewohnheiten stehen auf der Streichliste jener, die schon während Corona für ein anderes, ein solidarisches Konzept von Freiheit plädierten. Doch regelmäßig wird übersehen, dass man dem Gegner solche Verbote, wie schon Lockdowns oder 2G-Regeln, schwerlich als Freiheitsgewinn verkaufen kann. Gleiches gilt für Plattformregulierung, Meldestellen, Hausdurchsuchungen zur Einhegung der Meinungsfreiheit im Namen der Meinungsfreiheit. Auch hier wird der öffentliche Spielraum nicht etwa solidarisch erweitert, sondern bevormundet und eingeschüchtert.
Wann immer sich diese beiden Fronten auftun, gibt es Krach. Die libertäre Seite kritisiert staatliche Übergriffigkeit und denunziert die Untertänigkeit des politischen Gegners. Man stellt sich den Bürger und die Bürgerin wider besseres Wissen als maximal mündig und eigenverantwortlich vor. Die andere Seite setzt mutlos auf Sanktionen, weil sie den Glauben an eine autonome Pflichterfüllung aufgegeben hat. Sie imaginiert sich den Gegner als renitenten Egomanen, der solidarisch schikaniert werden muss. Das Interessante an dieser Polarität ist: Obwohl sich beide Seiten allergisch meiden müssten, weil es nichts bringt, sich gegenseitig anzukeifen, ziehen sie sich magisch an. Sie verhalten sich parasitär symbiotisch, indem sie sich gegenseitig zu immer neuen Provokationen zwingen.
Der vermeintliche Gegensatz wird so – von vielen unbemerkt – zu einer unheilvollen Allianz: Die neue Verbotskultur ist selbst nur das Abfallprodukt einer zur Willkürfreiheit tendierenden Ich-Bezogenheit. Und diese Ich-Bezogenheit ist oft auch eine Überreaktion auf kollektivistische Zumutungen. Die eine Seite begeht den Denkfehler, man könne Solidarität erzwingen. Die andere Seite sitzt dem Irrtum auf, man könne ganz ohne ein gelebtes „Wir“ auskommen. Der Libertarismus setzt zu wenig soziale Bindungskräfte frei, der Kollektivismus zu viel. Doch zugleich gibt es eine aufschlussreiche Gemeinsamkeit: Man geht jeweils vom egoistischen Individuum aus, das entweder in Ruhe gelassen oder aber durch Sanktionen gegängelt werden muss. In beiden Fällen fehlt ein souveränes Wir. Und damit wird beidseitig genau das selbstbezogene Subjekt bestätigt, das nicht von selbst aus seiner Komfortzone herauskommt.
Gesucht wird ein Konzept von Gemeinsamkeit, das die Gesellschaft weder libertär als reine Zweckgemeinschaft noch als paternalistische Zwangsgemeinschaft begreifen würde; ein politisches „Wir-Gefühl“, das sich die Bürgerinnen und Bürger als mitbetroffen und mitsorgend, als mitbestimmend und mitgestaltend denkt. Politik, das ist die öffentliche Auseinandersetzung um Angelegenheiten, die uns tendenziell alle betreffen; für die wir gemeinsam Verantwortung tragen müssen und bei denen wir ein Wort mitreden sollten, wenn wir diese Angelegenheiten zu unseren Gunsten arrangieren wollen.
In dieser politischen Kombination aus Mitbetroffenheit, Mitsorge, Mitbestimmung und Mitgestaltung läge der Schlüssel zu einem dezidiert „republikanischen“ Wir; einem Wir, das der falschen Alternative von libertärer Zweckgemeinschaft und kollektivistischer Zwangsgemeinschaft entgehen könnte. Es geht um die res publica, die „öffentliche Sache“, deren Gestaltung unsere gemeinsame Angelegenheit ist. Doch nicht wenigen Hörerinnen und Hörern wird bereits jetzt die häufige Nennung des Wortes „Wir“ ungut aufgestoßen sein. Bezugnahmen auf ein derart politisch verstandenes Wir stehen derzeit nicht sehr hoch im Kurs. Das liegt daran, dass dieses Wir von vielen als ab- und ausgrenzend verstanden und mitunter auch schmerzlich so erlebt wird.
In der Sprachwissenschaft wird zwischen einem „inklusiven“ und einem „exklusiven“ Wir unterschieden. Wenn zum Beispiel im Kollegium jemand sagt „Wir als Team müssen gemeinsam an einer Lösung arbeiten“, dann ist das ein inklusives Wir, das alle im Team einbeziehen will. Sagt hingegen jemand „Wir als Experten arbeiten an einer Lösung“, so wird die Gruppe derer, die sich auskennen, von jenen abgegrenzt, die als Laien nicht dazugehören. Entsprechend wird heute oft, wenn in der Politik von einem „Wir“ die Rede ist, misstrauisch unterstellt, dieses Wir sei exklusiv, abgrenzend oder gar aggressiv gemeint: „Wir können uns diesen Sozialstaat nicht mehr leisten.“ Das bedeutet leider oft: „Wir Steuerzahler haben genug von euch, die ihr auf unsere Kosten lebt“. Wenn aber jemand sagt: „Wir stehen für eine solidarische Gesellschaft, in der niemand ins Abseits gedrängt wird“, dann ist das inklusiv gemeint.
Die erste schwierige Frage lautet also: Ist ein republikanisches Wir denkbar, das nicht exklusiv ist? Erschwerend hinzu kommt der oft übersehene Unterschied zwischen einem konkreten und einem abstrakten Wir. Familie, Freundschaft, Liebe – das sind konkrete Wir-Beziehungen. Man erlebt sie im Alltag als handfeste, auf Austausch angewiesene Interaktionszusammenhänge. Wie aber ist das mit dem Wir von Gesellschaften, Staaten oder Kulturen? Dieses Wir bleibt oft abstrakt und wirkt dann teilweise illusorisch oder auch konstruiert. Ein abstraktes Wir wärmt niemandem das Herz. Und räumt auch nicht den Müll weg.
Man kann sich diesen Unterschied an den Debatten um Corona deutlich machen: Das konkrete Wir der Familie, Freundschaft, Nachbarschaft, der soziale Nahkontakt also, sollte durch „Social Distancing“ minimiert werden. Dies geschah im Namen einer abstrakten Solidargemeinschaft, die sich das pandemische Miteinander als voneinander isolierte Infektionsquellen wünschte. Auf Kosten ganz konkreter Wir-Beziehungen wurde so ein abstraktes Nebeneinander stabilisiert. Und was vorher als sozial galt – das nahe Miteinander –, galt nun als „unsozial“ und manchen gar als „asozial“.
Mit dieser Spannung ist eine zweite zentrale Frage aufgeworfen: Ist das Wir der Republik ein abstraktes oder ein konkretes? Und wie verhalten sich die vielen Ichs dazu? Deutet man es grammatikalisch, so fällt auf, dass man es sowohl beim Ich als auch beim Wir mit der 1. Person zu tun hat – einmal im Singular, das andere Mal im Plural. So betrachtet, ist das plurale Wir eine Anhäufung von singulären Ichs, damit zugleich aber auch ein erweitertes Ich. Dieses Ich benötigt mindestens ein anderes Du, damit aus einem Ich ein Wir wird. Aber haben sich mindestens zwei Ichs zu einem Wir zusammengetan, so ist zugleich auch mehr entstanden als nur eine Summe von Ichs.
Das spürt man, wenn ein solches Wir zerbricht: eine Liebe, ein Team, eine identitätsstiftende Gruppe. Dann bleibt oft ein verletztes Ich zurück, das schwächer scheint als jenes, das ursprünglich in dieses Wir hineingegangen ist. Die zentrale Bedeutung des Wir lässt sich auch daran ablesen, dass sowohl die sprachliche Fähigkeit als auch die biografische Dringlichkeit, „Ich“ zu sagen, ursprünglich aus dem Wir hervorgeht. „Der Mensch wird am Du zum Ich“, schrieb einst der Religionsphilosoph Martin Buber. Und im weiteren Verlauf des Lebens wird dieses Ich immer wieder ein neues Wir suchen, weil es sonst zu einsam wäre. Das gesuchte Wir hingegen neigt nicht selten dazu, dieses Ich zu vereinnahmen. Und dann zieht sich das Ich gegebenenfalls auch wieder beklommen oder genervt aus diesem Wir zurück. Und geschieht dies in großem Maßstab, hat die Gesellschaft ein Problem.
Dazu etwas „Küchensoziologie“. Zuletzt war von der unproduktiven Alternative zwischen einem libertären Individualismus und einem bevormundenden Kollektivismus die Rede. In der Soziologie konkurrieren hier zwei anschauliche Metaphern: die „Salad Bowl“ und der „Melting Pot“. In der gesellschaftlichen Salatschüssel bleiben die einzelnen Zutaten beziehungsweise Individuen weitgehend getrennt und sichtbar. Sie werden lediglich locker durch ein Dressing zusammengehalten. Zum Beispiel durch das Gesetz. Anders beim Melting Pot, der ursprünglich ein „Schmelztiegel“ ist. Besser noch passt im Fall der Küchensoziologie der Eintopf: Hier werden die Individuen so lange verrührt und verkocht, bis ein undefinierbarer Brei entsteht. Die Integration kann so einen unguten Beigeschmack annehmen.
Für welche Alternative soll man sich entscheiden? Beiden Modellen gelingt es nicht, die Spannung zwischen Ich und Wir auszuhalten oder gar produktiv zu wenden. Immanuel Kant hat dieses Hin und Her einmal auf das schöne Bild der „ungeselligen Geselligkeit“ gebracht: Der Mensch, so Kant, ist von zwei antagonistischen Triebkräften beherrscht. Er will allein sein und er will oft auch mit anderen zusammen sein. War man länger allein, zieht es einen wieder zu den anderen hin. Und umgekehrt. Wichtig ist, dass Kant hier von „Antagonisten“ spricht. Das muss man sich wie in einem Fitness-Studio vorstellen: Trainiert man dort gezielt einen Muskel, zum Beispiel den Beuger, so tun man gut daran, immer auch den Gegenspieler, den Strecker, zu trainieren. Sonst entsteht ein Ungleichgewicht. Ein auch ästhetisch ansprechendes Bild ergibt sich nicht dann, wenn beide Muskeln erschlaffen, sondern wenn sie beide trainiert sind und jeweils zur anderen Seite hin ziehen.
Die Gesellschaft ist keine Wellness-Oase, sondern das durchaus anstrengende, aber produktive Gegeneinander von Ich und Wir. Entspannung wäre nur dann zu haben, wenn einem der beiden Antagonisten die Luft ausginge. Im Fall eines Verschwindens des Individuums wäre der Sieg von Konvention und Kollektiv gegeben, im Fall allzu vieler renitenter Individuen der drohende Zerfall der Gemeinschaft. Ein republikanisch integriertes Gemeinwesen wäre die Alternative. Das Individuum darf hier Individuum bleiben. Zugleich hätte man es jedoch mit Individualität auf der geteilten Grundlage einer gemeinsamen Idee zu tun, wo es hingehen soll. Diese Identifikation mit einem gemeinsamen Ziel ist keine kollektivistische Bevormundung, sondern Ausdruck eines individuell bejahten Zugehörigkeitsgefühls. Die gesuchte Republik wäre nicht langweilig im Sinne der Aufhebung jener Spannung zwischen Ich und Wir, sondern deren politische Bewegungsform. Ob in der antiken Polis, im modernen Rechtsstaat, in der heutigen Großstadt oder direkt im Kiez: Die Gemeinschaft fußt auf der geteilten Verantwortung für die res publica.
Mitbetroffenheit, Mitsorge, Mitbestimmung und Mitgestaltung: Es ginge um die aktive Realisierung identitätsstiftender Projekte „von unten“. Dieser Republikanismus der Halbdistanz setzt auf vergemeinschaftete Individuen, die gemeinsame Sache machen, dabei aber doppelt Abstand wahren: zur egomanischen Willkürfreiheit einerseits und zur kollektivistischen Unterwerfung andererseits. Hier wäre das Individuum weder bloß „Bourgeois“ noch „Untertan“, sondern „Citoyen“. Ein „eminent politisches Wesen“, wie Jean-Jacques Rousseau einst sagte, das sich an einem vernünftigen „Gemeinwillen“ zu orientieren vermag, ohne in die Falle kollektivistischer Übertölpelung zu tappen. In Ermangelung einer besseren Küchenmetapher mag einem die Pizza in den Sinn kommen: Die Zutaten bleiben erkennbar, aber auf einem geteilten Boden mit krossem Rand.
Welche Zutaten aber benötigt man für diesen geteilten Boden? Nach einer soziologisch gängigen Auffassung sind es vor allem „Werte“, die eine Gesellschaft zusammenhalten: Gleichheit, Gerechtigkeit, Freiheit, Vielfalt, Sicherheit oder Solidarität. Was aber häufig übersehen wird: Es ist immer auch eine genauere Vorstellung davon, wo es gemeinsam hingehen und wie es dort buchstäblich aussehen soll. Und zwar möglichst angenehm, ja, schön. Warum also nicht auch darüber streiten, wie die Gesellschaft schöner zu machen wäre? In Zeiten einer akuten Verwahrlosung öffentlicher Räume ginge es folglich nicht nur darum, den Republikanismus wiederzuentdecken, sondern um einen spezifisch ästhetischen.
Der ästhetische Blick interessiert sich dafür, wie der Mensch die Welt sinnlich wahrnimmt. Und es geht in der Ästhetik darum, wie unsere Gefühle, Erinnerungen und Fantasien zu dieser sinnlichen Erfahrung und ihrer erkenntnismäßigen Durchdringung beitragen. Man mag auf Anhieb glauben, dies sei vor allem auf dem Gebiet der Kunst relevant. Aber es gibt auch das Naturschöne, etwa beim Anblick von Bergen, einem Sonnenuntergang am Meer oder einer Blumenwiese. Und auch alle Hervorbringungen des Menschen – samt seiner urbanen Fehltritte – lassen sich design- oder alltagsästhetisch unter die Lupe nehmen: Straßen, Plätze, Parks, Gehwege, U-Bahnstationen, Gebäude, Fassaden, Werbeflächen, Stadtmöbel oder Denkmäler.
Ein wenig pathetisch hat dies einst ein ganz anderer Kanzler, und zwar Willy Brandt in seiner Regierungserklärung von 1973, ausgedrückt: „Unsere Bürger suchen trotz des Streits der Interessen eine Heimat in der Gesellschaft, die allerdings nie mehr ein Idyll sein wird – wenn sie es je war. Das Recht auf Geborgenheit und das Recht, frei atmen zu können, muß sich gegen die Maßlosigkeit der technischen Entwicklung behaupten.“ Und Brandt fährt fort: „Es geht – um das Wort aufzugreifen – um die Freiheit im Alltag. Dort fängt jene Selbstbestimmung des Einzelnen an, die sich in der freien Existenz des Bürgers erfüllt und unter den Pflichten und den Rechten der Nachbarschaft steht. In ihr soll der Bürger seine soziale und seine geistige Heimat finden.“
Diese Sätze klingen wie aus einer fernen Welt. Doch wer sich von ihnen für einen Moment das Herz erwärmen lässt, mag spüren, dass es hier nicht nur um sozialdemokratische Umverteilung, sondern auch um Sinnlichkeit geht. Die beschworene „Freiheit im Alltag“ zielt auf ein Heimatgefühl, dass nicht allein durch Sozialpolitik zu erreichen wäre. Es geht, wie Brandt sagt, um Pflichten und Rechte „der Nachbarschaft“, die eine nicht-idyllische Geborgenheit ermöglichen. Es klingt paradox, aber der Gedanke ist toll: Es geht um eine Einheit in der Vielheit von Lebensstilen, deren Einklang sich aus einem spannungsreichen Mit- und Gegeneinander ergäbe. Reibungen sind unausweichlich, aber auch erwünscht, weil sie die Gesellschaft herausfordern und voranbringen.
Versteht man die Gestaltung des öffentlichen Raums als eine Sache von Mitbetroffenheit, Mitsorge, Mitbestimmung und Mitgestaltung, so lautet die Frage: Wie wollen wir leben und wie soll es dort aussehen? Ein ästhetischer Republikanismus verschiebt den Fokus: Er fragt, ob Straßen, Gebäude, Nachbarschaften nicht nur funktional, sondern auch attraktiv, dem Wohlergehen zuträglich und sichtbarer Ausdruck geteilter Verantwortung sind. Mit Rousseau gesprochen, bedarf es eines stadtästhetischen Bürgersinns, der die Stadtgestaltung zu einer eminent politischen Aufgabe macht. Sie fordert Pflege, Struktur, Proportionen, Ordnung und nicht zuletzt ein Ethos ziviler Tugenden: Geschmack, Achtsamkeit, Sorgfalt oder Diskretion. „Zivil“ sind diese Tugenden, weil sie zu einer stilistischen Transformation bürgerschaftlicher Umgangsformen führen werden – vor allem zu mehr Takt und Höflichkeit.
Schon bald würde sich dies im derzeit diskutierten Stadtbild zeigen. Man schaut sich gemeinsam um im urbanen Niemandsland und fragt sich: Wollen wir so miteinander leben? Das ist doch nicht schön! Wer glaubt, man könne die Verwahrlosung öffentlicher Räume allein mit Bußgeldern, durch Remigration oder aber durch einen Umzug aufs Land bekämpfen, irrt. Es muss darum gehen, den arg strapazierten Lebensraum als einen geteilten wiederzuentdecken; als einen Raum, den es verantwortlich zu gestalten gilt. Dann ist nicht länger bloß die Frage wichtig, ob es hier vor Ort gerecht zugeht. In den Vordergrund rückt die Frage: Ist es hier schön?
Um eine berühmte Losung Willy Brandts zu variieren: „Wir wollen mehr Ästhetik wagen!“ Nur dann wird sich die Bevölkerung mit dem öffentlichen Raum identifizieren. Als Vorbild taugen Sportvereine, Nachbarschaftshilfe, Food‑Sharing, Reparatur-Cafés, Clean-Up-Challenges oder sonntägliche Spielstraßen. Die vormalige Abstraktheit des politischen Wirs wird so schrittweise konkretisiert: Wer den Kiez nicht länger nur als Nutzfläche versteht, sondern als den gemeinsam zu bewirtschaftenden Lebensraum, wird seinen Müll nicht länger unter sich lassen.
Der Psychologe Zimbardo ließ damals übrigens noch ein zweites Auto abstellen. Wieder ohne Kennzeichen, diesmal im schönen Palo Alto. Nichts geschah. Oder doch: Ein aufmerksamer Passant schloss die geöffnete Motorhaube… Auch der Kommunalpolitik vor Ort muss unmissverständlich klar sein, dass sie sich um das Ambiente kümmern muss. Sicher, über die Frage, was konkret „schön“ wäre, lässt sich streiten. Aber genau das wäre ein republikanischer Neuanfang: Man debattiert nicht länger nur über die ungerechte oder schlecht integrierte Gesellschaft, sondern endlich auch über die hässliche.
Im aktuellen Krisenmodus einer zerrütteten Diskurskultur mag das utopisch klingen. Es wäre wichtig, selbst noch die politische Auseinandersetzung im medialen Raum als einen ästhetisch verunstalteten Raum zu betrachten. Im Gekeife rechthaberischen Krawalls zeigen Menschen ihr hässliches Gesicht, ihren stillosen Charakter und ihre teilweise doch arg ramponierte Denkungsart. Schön wäre auch hier etwas anderes! Die gesellige Halbdistanz, die sich der Republikanismus wünscht, lässt Menschen zugleich autonom und nahbar sein. Unsere Gesellschaft mag viel zu groß sein, als dass wir alle miteinander befreundet sein könnten. Doch man muss nicht schon miteinander befreundet sein, um freundlich zu bleiben. Dann würden wir uns jeweils, ob auf der Straße oder im Diskurs, ein ganz anderes Gesicht zeigen. Auch dies wäre ein Anfang.
Kinderland - Die Welt der Erstlesebücher
Von Patricia Görg
Redaktion: Thorsten Jantschek
Regie: Anna Panknin
Ton und Technik: Jetmir Sherifi
Sprecherin: Janina Sachau
Von Patricia Görg
Redaktion: Thorsten Jantschek
Regie: Anna Panknin
Ton und Technik: Jetmir Sherifi
Sprecherin: Janina Sachau