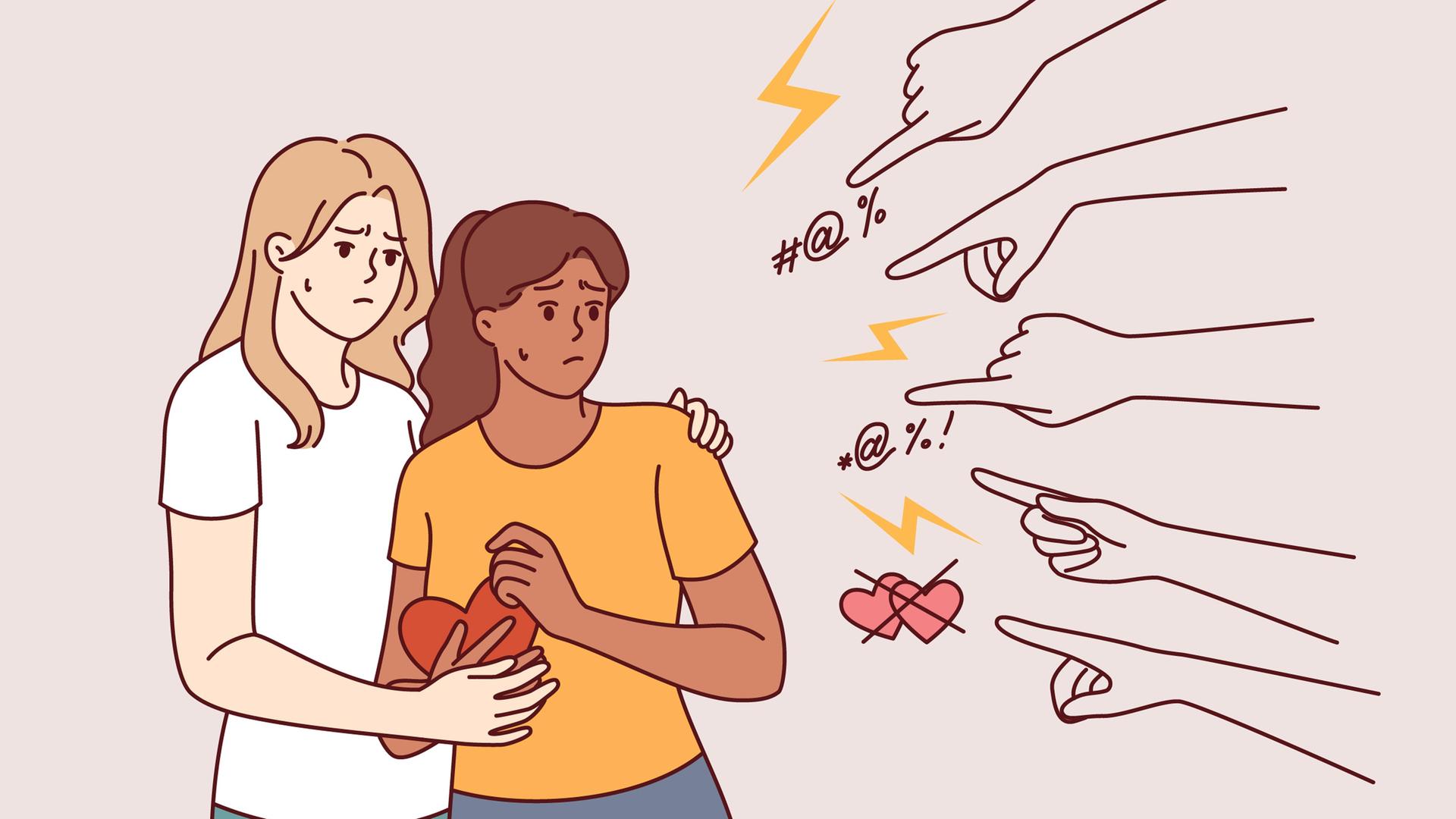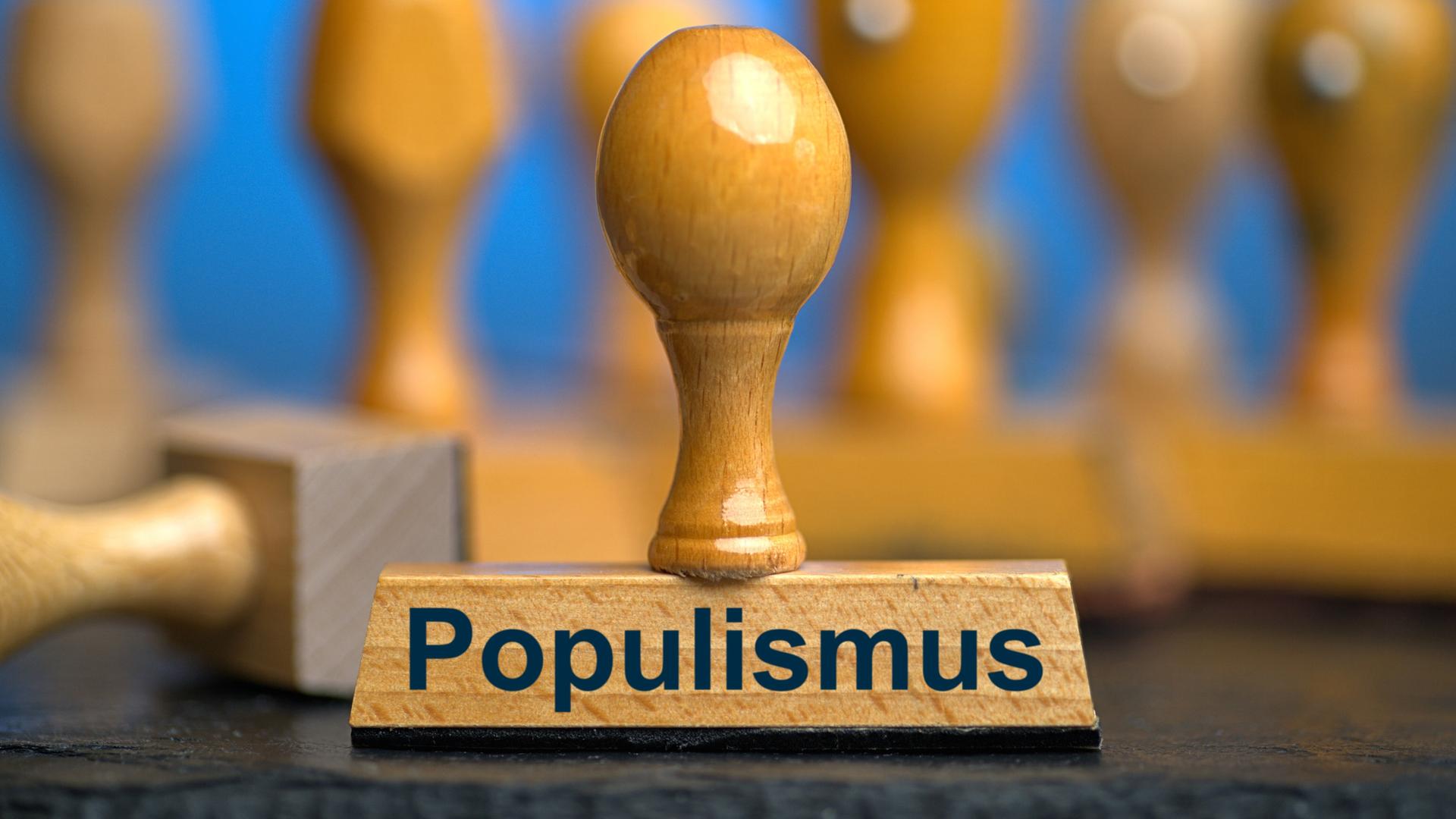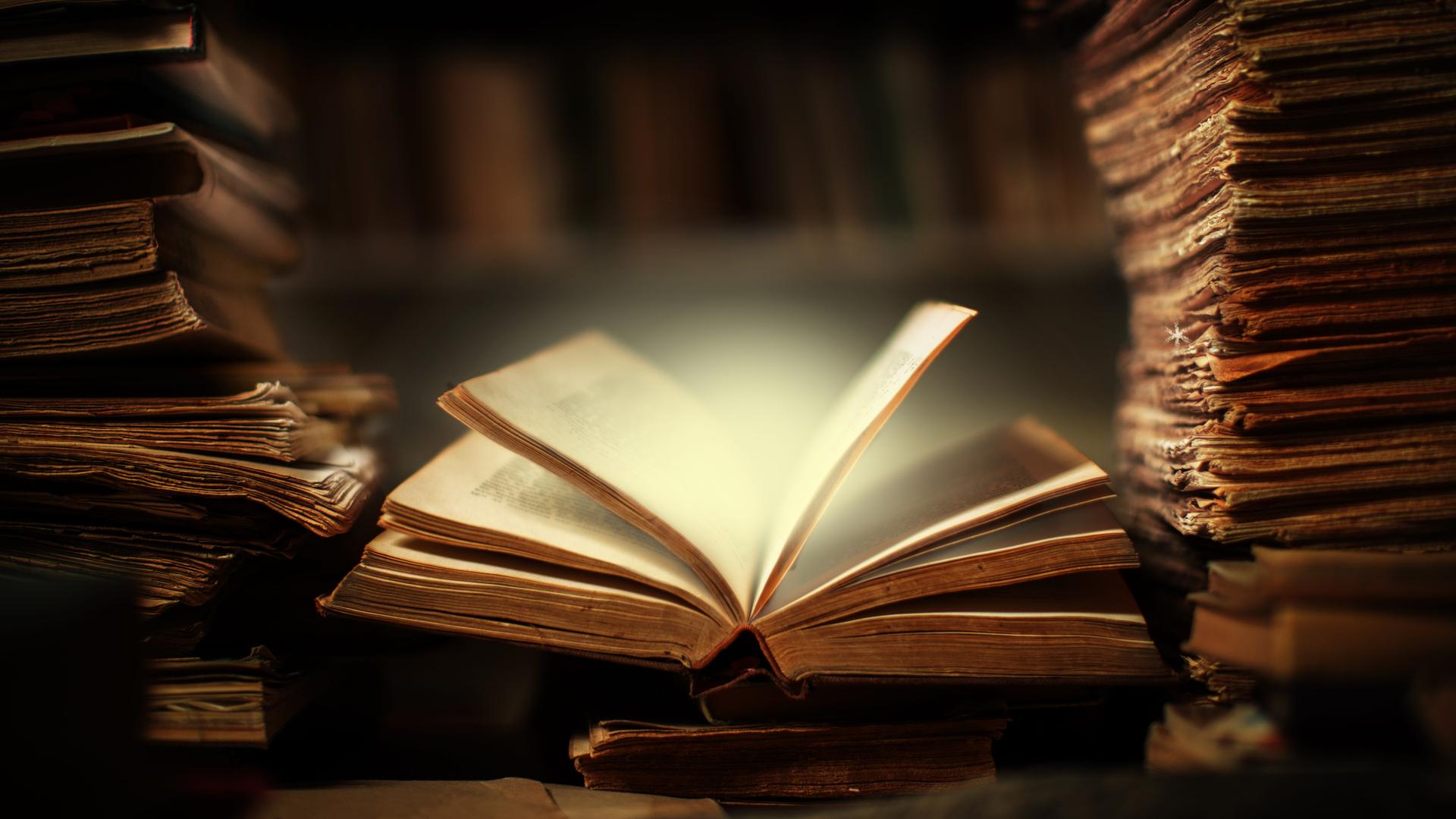Die Auseinandersetzung mit der Scham führt tief in kulturelle, religiöse und gesellschaftliche Strukturen. Sie zeigt sich als über Jahrtausende tradiertes Narrativ, als Werkzeug der Disziplinierung und Orientierung, als Grenze zwischen Individuum und Gesellschaft, Intimsphäre und öffentlichem Raum. Aus Perspektiven der Psychologie, Hirnforschung, Theologie, Geschichts- und Literaturwissenschaft, Soziologie und Gender Studies gilt es, die Scham in ihren Facetten zu hinterfragen: Wie wird sie vermittelt? Mit welchen Interessen? Ist sie ein Instrument der Kontrolle - oder ein Schutz der Würde? Und zuletzt: Was liegt jenseits der Scham? Vielleicht ein neuer Blick auf uns selbst. Und vielleicht sogar: das Paradies.
Ann Esswein ist freie Autorin und Journalistin, veröffentlicht Texte und Radiobeiträge etwa in der ZEIT, SWR, Deutschlandfunk, in Literatur-Magazinen und Anthologie. 2024 ist ihr Debütroman „Mimikry“ erschienen, im November 2025 erscheint der zweite Roman „Jahre ohne Sprache”. Sebastian van Vugt ist freier Autor und veröffentlicht kulturwissenschaftliche Texte und Prosa u.a. beim Kopf und Kragen Literaturverlag, der Anthologie „U0 Untergrundminiaturen“ und in Literatur-Magazinen.
„Beide, Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander“, heißt es in der Bibel noch vor dem Gesetzesverstoß. Als sie vom Baum der Erkenntnis gespeist haben, gehen ihnen die Augen auf: Sie erblicken sich, erkennen einander in ihrer Unterschiedlichkeit – und versuchen, sie voreinander zu verbergen. Sie ordnen sich fortan ein in binäre Codes. Sie schämen sich, wenn sie nicht auf der richtigen Seite stehen.
Die Scham durchdringt Adam und Eva, sie verstecken sich vor Gott. Sie fühlen sich beblickt, sie sind jetzt Subjekte im eigentlichen Sinne: Unterworfene des Blicks. Sie spüren eine Fremdheit in sich, die vorher nicht da war. Und auch Gott erkennt: Hier dürfen sie nicht mehr bleiben. Sie müssen das Paradies verlassen. Denn: Das Paradies ist ohne Scham. Wenn man es umdreht, hieße das dann, jenseits der Scham wäre das Paradies?
Wie schon bei Adam und Eva steht auch die Gesellschaft permanent vor der Herausforderung, aus Erkenntnissen Regeln und Richtlinien des Verhaltens zu definieren. Scham ist darin eine Verankerung, eine emotionale Kontrollinstanz. Mit dem feinen Unterschied, dass das Gefühl der Scham nicht meint, dass das Objekt des Tuns falsch ist. Ich an-sich bin es, die falsch ist oder deplatziert. Oder, wie Entwicklungspsychologin Jeanette Roos es beschreibt: „Scham ist eine „selbstwert‑relevante Emotion”. Schäme ich mich, schäme ich mich für mich und nicht für etwas – allerdings stets im Verhältnis zur vorherrschenden Norm. Der Soziologe Georg Simmel pointiert dazu in seinem Aufsatz „Die Psychologie der Scham”: „Indem man sich schämt, fühlt man das eigene Ich in der Aufmerksamkeit anderer hervorgehoben und zugleich, dass diese Hervorhebung mit der Verletzung irgendeiner Norm […] verbunden ist.“
Diejenigen, die Gesellschaft strukturieren und Regeln vorgeben können, setzen Scham gezielt dafür ein, zu zivilisieren. So schreibt der Soziologe Norbert Elias in „Der Prozess der Zivilisation“ über „De civilitate morum puerilium“ von Erasmus von Rotterdam, einem zentralen Werk westlicher Erziehungsnormen: „Dass man sich in dieser Diskussion häufig ausdrücklich auf die Schamgefühle beruft, unterstreicht die Verschiedenheit des Schamstandards.“ Anhand von Scham soll Gesellschaft geformt und vereinheitlicht werden. Im Umkehrschluss bedeutet sich zu schämen gleichzeitig, neuen Standards zu entsprechen. Scham kann auch als eine funktionale und nützliche Anpassungsreaktion betrachtet werden. Ein emotionaler Motor für die Transformation gesellschaftlicher Normen.
Für Erasmus von Rotterdam geht es wohl auch deshalb schlicht darum, so Elias, „Schamgefühle zu züchten“. Damit ist nicht weniger gemeint als die „Regelung des gesamten Trieb- und Affektlebens durch eine beständige Selbstkontrolle“, durch permanente Prüfung des Selbst, ob ich auf der richtigen Seite des Codes stehe und, wenn nicht, ich mich schämen muss. Die Selbstkontrolle soll es Gesellschaftssubjekten jederzeit ermöglichen, zwischen richtigem und falschem Handeln zu unterscheiden, die „Ausbildung einer differenzierten und festeren ‚Über‑Ich‘-Apparatur" zu fördern, wie es Elias beschreibt. Oder anders: Jeder Unterschied zwischen den einzelnen Menschen soll eingeebnet werden nach einem klaren Muster, was falsch und was richtig ist – für eine durchorchestrierte Moral der Gesellschaft. Alle Menschen sollen sich für das Raster entsprechend der allgemeingültigen Binärcodes formen. Wer auffällt, herausfällt, als anders sichtbar wird, soll sich schämen und beugen.
Die Norm und damit die Schamgefühle sind abhängig vom Gruppenbezug. Schamgrenzen werden in westlichen Gesellschaften auch dadurch stabilisiert, dass Menschen lernen, sich für ihre Scham zu schämen, beschreibt der Sozialwissenschaftler Stephan Marks. So muss die Scham zumeist unthematisiert bleiben. Es ist also ein Gefühl, das nicht sein soll, das sich selbst versucht, hinter sich zu verbergen. Wer sich schämt, offenbart, möglicherweise, anders zu sein, als die Norm. Also verbergen Menschen die Scham lieber und nicht nur das, weswegen sie sich schämen. So stabilisiert sich das Raster. Mit Blick auf die Schöpfungsgeschichte lässt sich also fragen: Was erkennen wir, wenn wir uns schämen? Und wie können wir verstehen, was wir erkannt haben könnten, wenn wir auf dieses Gefühl gar nicht so recht zugreifen können?
Kinder beginnen zwischen ihrem dritten und siebten Lebensmonat, sich zu schämen, schreibt Lea Schneider in ihrem Essay „Scham”. Scham und Beschämung ist ein zentrales Erziehungsmedium. Wer kennt nicht den Satz „Schäm dich!” oder in weicherer Form: „Das darfst du nicht tun!” „Sowas machen Mädchen nicht!” „Jungs kennen keinen Schmerz!” „Reiß dich zusammen!” All das sind Glaubenssätze, die der Familientherapeut Terrence Real als „normal traumatization” von Kindern bezeichnet. Diese Traumatisierung ist ubiquitär und zugleich normalisierend. Kinder lernen, was sie tun müssen, um auf der richtigen Seite der Unterscheidung zu stehen. Übertreten sie die Grenzen, lernen sie, sich zu schämen. Weil sie, an sich, falsch sind. Durch Scham lernen Kinder mitunter, welche Gefühle akzeptabel sind und welche nicht. Um sich gesellschaftlich einordnen zu können, muss eine aufwachsende Person sich an binären Codes orientieren, die je nach vorherrschender Norm unterschiedlich sind: Ob beispielsweise als Kind von Schichtarbeitern und Schichtarbeiterinnen oder von Eltern, die Goethe und Thomas Mann im Regal stehen haben, als sozialisiert „Junge” oder „Mädchen” oder als Kind von Bio-Deutschen oder mit einer komplexeren Herkunftsgeschichte. Die Binarität strukturiert Leben – und Scham ist ihr Steigbügelhalter.
Scham versteckt sich gut und gleichzeitig sind es die schmerzhaftesten und prägnantesten Erinnerungen. Jeder kennt Geschichten der Scham. Sie haben vielleicht sogar einen universellen Charakter. Sie passieren mir, uns, euch, auch du könntest sie erlebt haben.
Deine Kindheit und Jugend kommen dir in der Rückschau manchmal vor, wie die Geschichte deiner Körperlichkeit. Eigentlich hattest du ja gelernt, dass der Geist höher ist, wichtiger als der Körper. Dass es da eine Unterscheidung gibt. „Ich denke, also bin ich”, wie René Descartes schrieb. Doch jetzt merkst du, dass es da eine Verbindung gibt. Und sie ist heiß und tut weh.
Du sitzt in der Sauna. Das erste Mal überhaupt, obwohl du schon Anfang zwanzig bist. Deine neuen Kommilitonen und Kommilitoninnen sind auf die Idee gekommen, es wäre eine tolle Idee, in einem Holzhaus an einem See im Nichts in Schweden Silvester zu verbringen. Und jetzt sitzt du hier und fragst dich: Wie kann ich hier in dieser Hitze eigentlich sitzen, ohne von den nackten Körpern überfordert zu sein? Die Scham sei wie ein Geständnis, schreibt der Philosoph Jean-Paul Sartre in „Das Sein und das Nichts“. „Die Scham enthüllt mir den Blick des Andern und mich selbst am Ziel dieses Blicks. Sie lässt mich die Situation eines Erblickten erleben, nicht erkennen. Die Scham über sich, sie ist Anerkennung dessen, dass ich wirklich dieses Objekt bin, das der Andere anblickt und beurteilt.“
Schon der Moment, in dem ihr euch auszogt, war dir unangenehm gewesen. Du hattest dich abgewandt von den möglichen Blicken. Abgewandt davor, gesehen zu werden und selbst beim Blicken erblickt zu werden: Schamhaare, Schamlippen, überall Scham. Wie damals nach dem Sportunterricht. Wie sich die ganzen Klassenkameradinnen nach dem Unterricht ihre Shirts vom Leib rissen, unter die Dusche sprangen und sich und ihre Körper neckten, manche sich beschämt abwandten. Da wolltest du nicht dabei sein, zogst dir rasch die Straßenkleidung an, entflohst der Kabine. Du würdest zu Hause nach der Schule duschen – in der Einsamkeit deines Elternhauses. Die anderen fanden das eklig. Ihr sprühtet euch große Wolken AXE Alaska und Impulse Vanilla unter die Achseln. Es war der Geruch der Sauberkeit, der Geruch eurer Scham. Du wolltest nicht riechen wie du selbst. Nicht herausstechen in einer Weise, die dich entblößen könnte. Die Scham half dir als Kontrollinstanz, Teil der Gruppe bleiben zu können.
Und dennoch: „In der Scham hat das Subjekt einzig seine Entsubjektivierung zum Inhalt”, pointiert der Philosoph Giorgio Agamben. Das Subjekt werde dann „Zeuge des eigenen Untergangs, erlebt mit, wie es als Subjekt verlorengeht. Du merktest schon da also zweierlei: dass du nicht dazugehörtest, wenn du so warst, wie du vermeintlich warst. Und dass du gleichzeitig ein Teil von ihnen warst, wenn du dich anpasstest. Die Momente, in denen diese Neuordnung fraglich wurde, evozierten in dir Scham. Scham hat immer etwas mit Öffentlichkeit von etwas zu tun, was privat bleiben sollte, analysiert die Philosophin Hilge Landweer.
Während sich die Hitze der Sauna jetzt auf deine Haut legt, fragst du dich: Und wann kam wohl diese Scham in mich? Deine erste Erinnerung ist eine kindliche: Du spielst täglich mit deinen Freundinnen und Freunden in der Siedlung, in der du aufgewachsen bist. Du bist fünf, als du siehst, wie ein befreundetes Kind auf Toilette geht. Und du siehst noch etwas: Zwischen den Beinen deiner Freundin oder deines Freundes sieht es anders aus als bei dir. Etwas in dir sagt dir: Das muss ich gestehen! Das macht einen Unterschied. Woher kommt diese Erkenntnis? Wie bei Adam und Eva enthüllt die Nacktheit mit einem Schlag eure Fremdheit. Du fängst das andere Kind auf der Treppe ab, ziehst deine Leggins runter und zeigst, was da bei dir ist. Dem Kind ist das egal. Und du schämst dich. Du weißt nur: Du bist anders.
Den Zusammenhang zwischen Nacktheit und Scham hält die Entwicklungsbiologin Gabriele Haug-Schnabel für eine zentrale Entwicklung des Menschen: „Der Beginn der menschlichen Scham liegt nicht ohne Grund lange vor den körperlichen Veränderungen der Pubertät und erreicht mit dieser einen Höhepunkt. Es wird nun immer wichtiger, sich zu schämen: weil man Grenzen aufzeigen will, indem man sich abgrenzt. Die Scham sichert die Integrität und hilft, den für die Sexualität wichtigen Intimitätsbereich aufzubauen.”
Du bist etwa zehn. Die Sommerferien sind vorbei. Du hast sie damit verbracht, in Italien von allen denkbaren Vorsprüngen und Felsen Kopfsprünge zu üben. Dass du beim Schwimmen keinen Bikini trägst wie die größeren Mädchen, kommt dir selbstverständlich vor. Bis du bemerkst, dass etwas nicht stimmt. Dass da etwas ist, unter deiner Haut. Eine gekochte Bohne wächst an deiner rechten Brust. Sie flutscht hin und her. Du erzählst deinen Eltern nichts davon. Du willst keine Sorgen machen. Vielleicht hast du auch Krebs. Am Baggersee kauerst du in ein Handtuch gewickelt am Ufer. Du hast keine Lust mehr, Kopfsprünge zu üben. Die Bohne wird immer größer und du hast niemanden, mit dem du darüber reden kannst. Das, wovor du dich schämst, lässt sich nicht wegignorieren.
Erst ist da die Scham, dass etwas nicht in Ordnung ist, etwas Abnormales in deinem kindlichen Körper vor sich geht. Dann ist da die Peinlichkeit der anderen, was deinen Körper betrifft. Sie wird deine Scham. Bei C&A kauft deine Mutter dir ein Bustier. Es scheint wichtig zu sein, dass niemand deine Brustwarzen durch das T-Shirt sieht, aber auch wichtig, dass andere den Ansatz deiner Brüste sehen.
Brüste sind in deiner Jugend so präsent und so versteckt gleichzeitig, dass du dich manchmal nicht auskennst, in welche Richtung du dich schämen sollst. Erst schämst du dich, dass sie da sind, dann merkst du, dass andere sich schämen, wenn sie zu wenig da sind. Du stehst im Schulklo, willst eigentlich immer noch Kopfsprünge vom Dreimeterbrett üben, aber bemerkst, dass deine Freundinnen vor dem Schwimmunterricht mit ganz anderen Gedanken beschäftigt sind. Sie stopfen sich Taschentücher in den Bikini und, weil das nicht so gut funktioniert, bald Socken. Etwas an der Größe und Form der Brüste scheint entscheidend zu sein.
Aufwachsen ist eine Gratwanderung der binären Codes von richtig und falsch, aber auch: zwischen zu viel und zu wenig. Und dein Körper ist plötzlich Gegenstand einer öffentlichen Evaluation – der Möglichkeit, begehrt zu werden.
Scham gibt vor, die Intimität von Heranwachsenden zu schützen. Rückblickend ist es in deiner Jugend unter deinen Freunden und Freundinnen der Nährboden für Komplexe, Essstörungen und Bauchschmerzen. Anstatt interessiert auf die körperlichen Veränderungen anderer Personen zu blicken, lernst du, dich zu vergleichen und deine Defizite zu bemessen. „Wir lernen, dass wir nicht nur Beobachtende sind, sondern gleichzeitig auch immer die Objekte von Beobachtung”, schreibt Laura Späth in ihrem Buch about shame. In diesem Blick der anderen liegt nach Jean-Paul Sartre die erste Möglichkeit für Scham: „Die Scham aber ist, Scham über sich, sie ist Anerkennung dessen, dass ich wirklich dieses Objekt bin, das der Andere anblickt und beurteilt”.
Es ist Ende des Studiums. Bis zuletzt bist du nicht gerne in die Sauna gegangen. Du hast die Abschlussarbeit geschrieben. Eigentlich hast du dir keine Sorgen gemacht. Du warst immer gut in dem, was du getan hast, hast immer Bestnoten. Jetzt bist du 26. Du lebst in einer neuen Stadt mit deiner Beziehung. Du bist vollgepumpt mit Wissen, hattest überlegt zu promovieren, willst aber erstmal Geld verdienen. Du hast gelernt: Nur wer leistet, ist etwas wert. Wer arbeitslos ist, sollte sich schämen. Du willst erfolgreich sein, deine Klasse halten. Der Soziologe Sighard Neckel schreibt zu sozialer Scham: „Beschämung [...] sind soziale Techniken, um eigene Vorteile gegenüber fremden Ansprüchen konservieren zu können.” Du hast den Glaubenssatz, du solltest nicht arbeitslos sein. Du willst, dass man dich braucht. Also sitzt du in deiner Wohnung und schreibst Bewerbung um Bewerbung, während deine Beziehungsperson weiter zur Uni geht. Abends kochst du. Immerhin darauf gibt es Feedback.
Je mehr Absagen kommen, desto unangenehmer wird es dir. Deiner Beziehungsperson sagst du nichts. „Scham betrifft uns so grundlegend, weil sie die Abgrenzung eines Bewusstseins von allen Anderen markiert – weil sie auf die eigene Oberfläche verweist, auf das Nicht-Eins-Sein mit der restlichen Welt”, so beschreibt es die Autorin Lea Schneider. Da ist eine Trennung, die du spürst. Du kannst das Versprechen, das du dachtest zu sein, nicht mehr halten. Du liegst im Bett, während deine Beziehungsperson im Seminar diskutiert. Blickst in deinen Laptop. Die Tage vergehen. Auf die Frage, ob du schon eine Antwort bekommen hast, lügst du.
Scham als stille Geste, wie Norbert Elias schreibt: „der Konflikt, der sich in Scham‑Angst äußert, ist nicht nur ein Konflikt des Individuums mit der herrschenden, gesellschaftlichen Meinung, sondern ein Konflikt, in den sein Verhalten das Individuum mit dem Teil seines Selbst gebracht hat”. Es ist also ein Konflikt, den du gelernt hast, mit dir auszufechten. Internalisierte gesellschaftliche Meinung, vor der du dich als unterlegen anerkennst. Die Scham schützt aber auch dein Selbstwertgefühl: Dein äußeres Bild bleibt unbeschadet. Die Phasen im Bett werden länger. Du hörst auf, das Bett zu machen, legst dich nach dem Frühstück wieder rein, bingst Game of Thrones und House of Cards, schreibst weitere Bewerbungen. Assistenz der…, Aushilfe, Minijob. Sogar ein unbezahltes Praktikum würdest du mittlerweile nehmen.
„Die Scham wurde für mich zu einer Seinsweise”, formuliert Annie Ernaux in Die Scham. Auch deinen Eltern hast du gesagt, dass alles gut läuft, und kochst einen Nudelauflauf. Du gräbst lieber deinen Kopf tiefer ins Kissen, als dich vor irgendjemandem rechtfertigen zu müssen. „Feelings of shame involve a painful scrutiny of the self – a feeling that I am unworthy, incompetent and bad”, pointiert die Psychologieprofessorin June Price Tangney.
Du fühlst dich unverbunden. „The one thing that keeps us out of connection is our fear that we are not worthy of connection“, fasst die Sozialwissenschaftlerin Brené Brown dieses Gefühl in ihrem TED-Talk zu Scham zusammen. Die Absagen verschweigst du, irgendwann selbst die Bewerbungen: Enttäuschungsprophylaxe. Zwar hält die Scham dich einsam und verhindert, dich in deinem schlechten Gefühl anderen zu öffnen. Sie schützt dich aber auch, legt sich wie ein warmes Kleid um dich, hält dein Gefühl des Schlechtseins im Verborgenen. Deine Würde ist der möglichen Abwertung von außen nicht ausgesetzt.
Das wie ein Kaugummi in die Länge gezogene Studium ist vorbei, diese nicht endende Jobsuche ist vorbei, du bist wieder Single. Du beginnst deinen ersten Job überhaupt. Ximena und du, ihr teilt euch ein Büro. Es ist ein Dienstag, als du die Arbeit gemeinsam mit Ximena verlässt. Du willst sie näher kennenlernen. Du fragst sie, woher sie kommt. „Aus Kassel”, antwortet sie trocken. Du lachst auf, merkst, dass da was komisch ist und hakst dennoch nochmal nach. Du willst dich erklären. Das sei ja auch nicht das gewesen, was du hattest wissen wollen: „Ich meine, was dein Hintergrund ist. Also woher deine Eltern kommen oder Großeltern.” Ximena dreht ihren Kopf zu dir. Ihr Gesichtsausdruck ist angespannt, aber weich. Nach kurzem Zögern sagt sie: „Das ist rassistisch, das weißt du schon, oder?” Dir wird heiß, irgendwas kriecht von innen deine Haut hinauf Richtung Kopf: Scham. Rassistisch? Ich bin doch kein Rassist, denkst du. Oder hast du da was übersehen? Was stimmt nicht mit mir?
Dein Gesicht beginnt zu glühen. Du willst dich rechtfertigen. Das hast du ja nicht so gemeint. Wie du es denn dann gemeint hast? Ihre Stimme klingt plötzlich schärfer in deinen Ohren. Schamgefühl bedeutet auch die „Kränkung eines Individuums, das glaubt, sich aus sich selbst heraus zur Einheit bringen zu können”, analysieren Alfred Schäfer und Christiane Thompson. Du spürst, dass etwas in dir auseinanderfällt. Das, was du eigentlich sein wolltest, und das, was du plötzlich im Blick der anderen bist. Du fühlst dich in die Ecke gedrängt. Da schweigst du einfach. Du läufst neben ihr her, du sagst nichts, weder Entschuldigung noch Rechtfertigung. „Selten fühlen sich weiße Menschen so angegriffen, allein und missverstanden, wie dann, wenn man sie oder ihre Handlungen rassistisch nennt. Das Wort ‚Rassismus’ wirkt wie eine Gießkanne voller Scham, ausgekippt über die Benannten. Weil die Scham so groß ist, geht es im Anschluss selten um den Rassismus an sich, sondern darum, dass ich jemandem Rassismus unterstelle, verweist die Journalistin und Autorin Alice Hasters auf eine der Strategien, die Scham in Bezug auf Zerbrechlichkeit als Schutzreaktion kennt. Und in diesem Moment weißt du: Keine Theorie der Welt könnte deine Röte verbergen. Zwar hilft die Scham, dein Kongruenzgefühl zu schützen. Sie verhindert aber auch den Anstoß zur Verhaltensänderung individuell und gesellschaftlich.
„Shame thrives on secrecy, silence, and judgment”, schreibt Brené Brown in Atlas of the Heart. In vielen Momenten der Scham verfallen Menschen in Schweigen, durch das sie das Unwohlsein aushalten können.
Auch in anderen Kontexten führt Scham zu verstummter Einsamkeit. Im Wartezimmer deiner Frauenärztin krallt sich das Schamgefühl in deine Schultern. Obwohl du jetzt erwachsen bist, schämst du dich so sehr, dass es dir die Sprache nimmt, gerade dann, wenn du sie am meisten brauchst. Du weißt nicht, ob du schwanger bist und noch viel weniger, was passieren könnte, wenn doch. Dort, wo du herkommst, würde niemand offen über eine Abtreibung sprechen.
Du hast das Gefühl, die anderen Frauen könnten dir ansehen, warum du hier bist. Obwohl du die Glaubenssätze deiner Herkunft längst abgelegt zu haben glaubst, hast du das Gefühl, nicht bei deinem Namen aufgerufen zu werden, sondern als eine, die im Zweifelsfall komplett allein mit der Katastrophe in ihrem Inneren ist. Ein ähnliches Gefühl in einem Wartezimmer beschreibt Annie Ernaux in Das Ereignis. Stumm nebeneinandersitzend mit Personen, die vermutlich auch ein Geheimnis in sich tragen. Vorgänge, die biologisch die normalsten der Welt sein könnten, aber so schambehaftet, dass hier jede für sich allein sitzt.
In dem Wartezimmer schämst du dich zehn Stockwerke tiefer, weil du darüber nachdenkst, etwas zu tun, das noch immer juristisch an einer Straftat streift. Du denkst die Glaubenssätze deiner Großeltern bis in die Gegenwart. Du weißt, dass es für dich richtig ist, was du tun würdest. Doch die Stimmen deiner Vorfahren sagen dir, dass es falsch wäre. Der Konjunktiv der Scham reißt an dir.
Ob du schwanger sein könntest, das ist die Sorge, die du vor deiner Umwelt gut verstecken willst. Dort wo du herkommst, würdest du niemals darüber sprechen. Aber es gänzlich zu verschweigen, dafür würdest du dich in deinem feministischen Freundeskreis schämen.
„Man kann sich durchaus für eine Norm schämen, die man aus rationaler Einsicht nicht anerkennt”, behauptet die Philosophin Hilge Landweer.
In diesem Ausnahmezustand fühlt sich die Scham schützend an. Der Psychologe Léon Wurmser beschreibt sie in Die Maske der Scham als „eine unentbehrliche Wächterin der Privatheit und der Innerlichkeit, eine Wächterin, die den Kern unserer Persönlichkeit schützt”. Du willst nicht, dass Menschen bemerken könnten, was in deinem Innersten vor sich geht, schon gar nicht, dass sie mitreden könnten. Aber es wirkt, als gehöre dein Reproduktionsapparat mit samt deines weiblichen Körpers damit trotzdem nicht dir allein, sondern auf den moralischen Verhandlungstisch deiner Ahnen.
Die Scham wirft ein Raster über die Gesellschaft. Du bist darin eingewoben, aber willst auch nicht rausfallen. Über Jahrhunderte überliefert, wird dieses Raster nur langsam angepasst und sorgt dafür, dass wir verstummen. „Das Schlimmste an der Scham ist, dass man glaubt, man wäre die Einzige, die so empfindet“, schreibt Annie Ernaux. Es ist ein sich selbstfütterndes System: Es gäbe keinen rationalen Grund, sich für eine ungewollte Schwangerschaft zu schämen.
Dein schamgetränktes Leben fühlt sich hunderte Meilen entfernt vom Paradies an. Was würde passieren, wenn wir die Scham abtragen würden, wie die Publizistin Carolin Emcke in ihrem Essay „Ja heißt ja und…“ beschreibt. Könnten wir so die Distanz zum Paradies reduzieren, am Ende sogar wieder dorthin zurückkehren?
Hier kommt der Konjunktiv der Scham erneut ins Spiel. Die Scham weist nicht nur auf das hin, was man durch die Scham wird, auf das, wie man bestenfalls sein und wie man handeln sollte. Sie zeigt im Konjunktiv ihre Gegenseite: Was, wenn du heute nackt durch die Fußgängerzone liefest? Wenn du deinem Crush einfach sagen würdest, dass du verliebt bist? Was, wenn du eingestehen würdest, dass deine rassistische Nachfrage einen Mangel an Auseinandersetzung in seinem Grund hat? Was, wenn du das Periodenblut auf deiner Hose Periodenblut sein ließest oder dich so zeigtest wie du eben einfach bist? Oder wenn die Frauen im Wartezimmer
über nicht-gewünschte Kinder, Wunschkinder und ihre Bedeutung für ihr Leben sprechen würden? Kurz: Was, wenn Menschen sich aus Scham nicht in sich selbst verstummt zurückziehen würden, um ihr Innerstes zu schützen, sondern sich verletzlich zeigten? So wie der Soziologe Didier Eribon feststellt: „Exhibitionismus ist die Umkehrung der Scham, aber es geht nicht anders.”
In diesem Paradies der Schamlosen wäre das Prinzip von Mehrheitsgesellschaft überholt, weil sich Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit erkennen und akzeptieren könnten. In der „Nacktheit unseres Antlitzes”, wie der französische Philosoph Emmanuel Lévinas schrieb. Statt sich der Andersheit zu schämen oder andere dafür zu beschämen, könnte sich ein Raum der Neugier ergeben. Genauso wie ein Raum des Lernens in Momenten, in denen Menschen erführen, dass sie andere vor den Kopf gestoßen haben. Wir könnten ehrlicher unsere Abgründe zeigen, ohne Angst, ausgestoßen zu werden, und uns zugleich bewusst machen, wenn wir Grenzen anderer überschreiten. Eine solche Schamlosigkeit eröffnete zwar die Möglichkeit radikaler Diversität, brächte aber ebenso eine Vervielfachung von Konflikten mit sich.
Die Vervielfachung von Konflikten führte wiederum zu neuen Regeln, Grenzen, die gesetzt würden, um Klarheit zu schaffen. Aber Gott vertrieb Adam und Eva nicht aus Willkür. Die Ursünde ist nicht ohne Grund von Scham umgeben. Ein Zusammenleben ist, ganz ohne Scham, schwer vorstellbar. Eine paradiesische Gesellschaft wäre nur in kleinen Enklaven denkbar, an einsamen Stränden, in vergessenen Höhlen. In unserem komplexen Zusammenleben aber hilft die Scham, mit anderen in einem Raum zu koexistieren. Sie schützt die Intimsphäre von Kindesbeinen an. Sie sichert Würde und Kongruenzgefühl, wenn Menschen drohen, an einer positiven Vorstellung von sich zu scheitern. Kurz: Sie hilft, Regeln des Verhaltens einzuhalten, die uns vor und mit anderen akzeptabel machen.
Eine Gesellschaft auf dem Weg hin zu einem paradiesischeren Zustand wäre also eine, die die Bedingungen ihrer Erkenntnisse ihrer Selbst, die Parameter ihrer Scham genau beobachtet und sich die Frage stellt: Worin ist es wirklich wichtig, dass wir uns unterscheiden? Und wie viel Möglichkeitsraum jenseits binärer Codes können wir als Gewinn verbuchen? Im Sinne Carolin Emckes: Es geht darum zu unterscheiden, was veraltet, nicht mehr brauchbar ist. Und das als Gesellschaft zu diskutieren, anstatt zu verstummen. So erklärt der trans-Autor und Buchhändler Linus Giese in einem Interview: „Ich musste wirklich eine jahrelange Scham durchbrechen, die mich sehr belastet und eingeschränkt hat. […] Wie viel entspannter es sich leben lässt, wenn man sich ein bisschen davon befreit.” Oder, wie es James Baldwin in They Can’t Turn Back in Worte fasste: „It took many years of vomiting up all the filth I’d been taught about myself, and half-believed, before I was able to walk on the earth as though I had a right to be here.“ Keine Rückkehr ins Paradies, aber Stück für Stück Erleichterung.