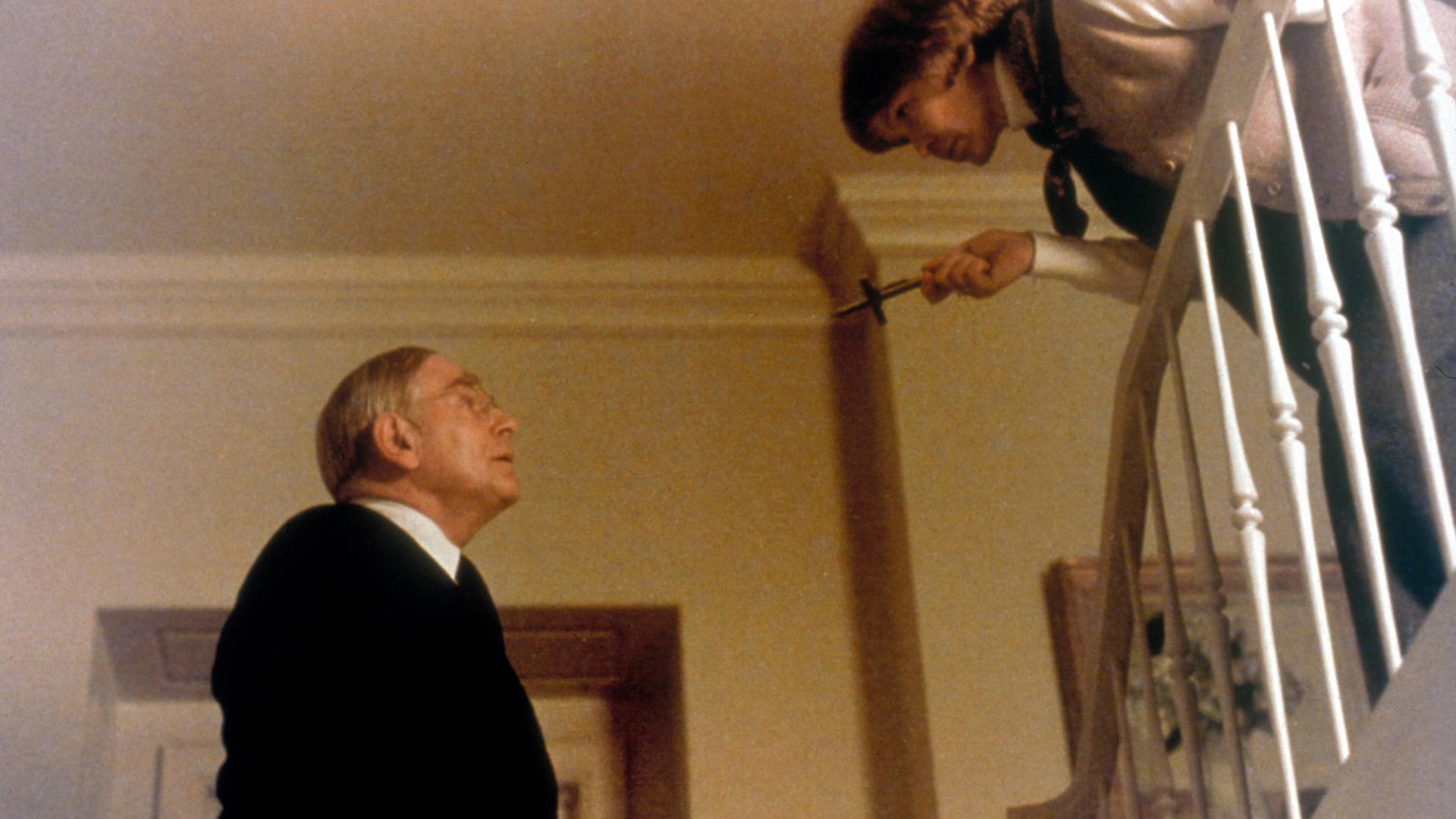Der Weltklimagipfel in Ägypten war kein großer Wurf - im Gegenteil. Und auch bei den bisherigen Klimazielen ist die große Frage: Wie sollen denn zumindest die erreicht werden? Auch hierfür braucht die Politik die Wissenschaft: Wissen darüber, wie konkrete Klimamaßnahmen in einer Gesellschaft am besten umgesetzt werden. Ein Tempolimit zum Beispiel, Energiesparmaßnahmen, Änderungen bei der Ernährung und so weiter - alles Themen mit reichlich Zündkraft, weil sie eben in das Leben von Menschen eingreifen. Zuständig dafür sind auch die Sozialwissenschaften - aber kommt hierzu aus den Sozialwissenschaften genug Wissen?
Stefan Liebig ist Soziologe an der Freien Universität Berlin, Professor für Empirische Sozialstrukturanalyse – und war bis vor kurzem Direktor des sozio-ökonomischen Panels, also der größten repräsentativen sozio-ökonomischen Langzeitstudie in Deutschland.
Stefan Liebig kritisiert, dass der Politik Wissen darüber fehle, wie die Menschen mit der Krise und den Veränderungen umgehen. Andernfalls bestehe das Risiko, dass „ineffiziente“ Maßnahmen auf den Weg gebracht werden und die eigentlich „Interessen und Präferenzen“ der Bürgerinnen und Bürger nicht beachten würden – und das könnte Konsequenzen bei deren Wahlverhalten mit sich bringen. Die Corona-Pandemie sei zwar eigentlich ein „Impuls“ gewesen, sozialwissenschaftliche Forschungsdaten an die Politik weiterzuleiten – letztendlich sei aber in den sozialwissenschaftlichen Disziplinen eine „gewisse Scheu“ zu konstatieren, Fördermittel in signifikanter Höhe auch einzufordern. Möglicherweise gäbe es auch ein methodisches Forschungsproblem in den Sozialwissenschaften – das immer wieder neu Beleuchten bereits eigentlich hinreichend erforschter Themenkomplexe
Das Interview im Wortlaut
Kathrin Kühn: Herr Liebig, herzlich willkommen ich sage mal zu einer erneuten Reflektion in Sachen Methodik, wir haben das ja schon einmal zur Pandemie gemacht im Juli. Vielleicht, um klarzumachen, worum es hier geht - also ein wenig habe ich das ja schon angedeutet - wo bräuchten wir denn dringend Wissen aus den Sozialwissenschaften zur Klimapolitik, was sind da Felder?
Stefan Liebig: Also wir haben auf der einen Seite natürlich schon eine Reihe von Informationen und Kenntnisse aus der Grundlagenforschung. Aber was wir natürlich unmittelbar benötigen, sind Beobachtungen, wie sich einzelne Haushalte tatsächlich verhalten, wie sie damit umgehen, dass sie nun in einigen Bereichen auch durch die Klimakrise und durch die damit einhergehenden Veränderungen Verluste in Kauf nehmen müssen, und wie sie mit diesen Verlusten umgehen.
Kathrin Kühn: Und was passiert, wenn es das jetzt nicht gibt, ja auch zeitnah - nicht erst in ein, zwei, drei Jahren, dass man seine Studien veröffentlicht hat und diskutiert hat?
Stefan Liebig: Also was daraus entstehen kann, ist, dass Politik eben bestimmte Entscheidungen trifft, die möglicherweise nicht von den Bürgerinnen und Bürgern so akzeptiert werden, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, dass Politik Maßnahmen auf den Weg bringt, die letztendlich auch ineffizient sind. Also als Beispiel dieses Gießkannenprinzip, weil sie damit Personen oder Haushalten, Dinge oder Unterstützung zuteilwerden lässt, die diese Haushalte oder Personen überhaupt nicht benötigen. Oder wo sie sagen, ja, das sind die sogenannten Peanuts, das heißt, da werden Ressourcen oder Mittel, in dem Fall auch Steuermittel ineffizient eingesetzt. Und die fehlen natürlich dann in anderen Bereichen, die möglicherweise wichtiger sind.
Kathrin Kühn: Wenn ich das jetzt einmal versuche, zusammenzufassen, dann haben wir da sozusagen ein nicht gutes Zusammenspiel. Es fehlt für das aktuelle Handeln aktuelles Wissen, und deswegen kann das aktuelle Handeln letztlich zu falschem Einsetzen von Geld führen, das man ja sicherlich dann auch für effektivere und andere Maßnahmen noch brauchen könnte - also ein Verschleudern in der allerwichtigsten Krise, die wir eigentlich vor uns haben, jetzt?
Stefan Liebig: Genau. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Maßnahmen beschlossen werden, die eben dermaßen entgegen der Interessen und der Präferenzen auch der Menschen gehen, dass sie entsprechende politische Reaktionen auch zeigen, also zum Beispiel im Wahlverhalten.
Stefan Liebig: Also wir haben auf der einen Seite natürlich schon eine Reihe von Informationen und Kenntnisse aus der Grundlagenforschung. Aber was wir natürlich unmittelbar benötigen, sind Beobachtungen, wie sich einzelne Haushalte tatsächlich verhalten, wie sie damit umgehen, dass sie nun in einigen Bereichen auch durch die Klimakrise und durch die damit einhergehenden Veränderungen Verluste in Kauf nehmen müssen, und wie sie mit diesen Verlusten umgehen.
Kathrin Kühn: Und was passiert, wenn es das jetzt nicht gibt, ja auch zeitnah - nicht erst in ein, zwei, drei Jahren, dass man seine Studien veröffentlicht hat und diskutiert hat?
Stefan Liebig: Also was daraus entstehen kann, ist, dass Politik eben bestimmte Entscheidungen trifft, die möglicherweise nicht von den Bürgerinnen und Bürgern so akzeptiert werden, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, dass Politik Maßnahmen auf den Weg bringt, die letztendlich auch ineffizient sind. Also als Beispiel dieses Gießkannenprinzip, weil sie damit Personen oder Haushalten, Dinge oder Unterstützung zuteilwerden lässt, die diese Haushalte oder Personen überhaupt nicht benötigen. Oder wo sie sagen, ja, das sind die sogenannten Peanuts, das heißt, da werden Ressourcen oder Mittel, in dem Fall auch Steuermittel ineffizient eingesetzt. Und die fehlen natürlich dann in anderen Bereichen, die möglicherweise wichtiger sind.
Kathrin Kühn: Wenn ich das jetzt einmal versuche, zusammenzufassen, dann haben wir da sozusagen ein nicht gutes Zusammenspiel. Es fehlt für das aktuelle Handeln aktuelles Wissen, und deswegen kann das aktuelle Handeln letztlich zu falschem Einsetzen von Geld führen, das man ja sicherlich dann auch für effektivere und andere Maßnahmen noch brauchen könnte - also ein Verschleudern in der allerwichtigsten Krise, die wir eigentlich vor uns haben, jetzt?
Stefan Liebig: Genau. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Maßnahmen beschlossen werden, die eben dermaßen entgegen der Interessen und der Präferenzen auch der Menschen gehen, dass sie entsprechende politische Reaktionen auch zeigen, also zum Beispiel im Wahlverhalten.
Kathrin Kühn: Vielleicht kommen wir erst mal noch auf den ersten Punkt zurück, also das Fehlen dieses aktuellen Wissens. Dass also, sagen wir mal, einfach auch keine Grundlage für die Politik da ist. Ist es denn in den Sozialwissenschaften Thema; also ist man sich dessen bewusst?
Stefan Liebig: Nun, die Pandemie war eigentlich der Aufhänger dafür oder war der Impuls. Die Pandemie war der Impuls, über genau derartige Dinge nachzudenken. Ich bin mir da nicht wirklich sicher, ob wir viel gelernt haben. Es gibt einige Initiativen, die vor dem Hintergrund auch darüber nachgedacht haben, wie wir schneller an Forschungsdaten in derartigen Krisensituationen kommen, vor allem auch qualitätsgesicherten Forschungsdaten, die dann auch in die politischen Prozesse und Entscheidungsprozesse mit einfließen können.
Kathrin Kühn: Und hat das schon das gesamte Fach durchdrungen? Verspüren Sie sozusagen Erdbebenwellen, dass da der Wille ist, etwas zu ändern?
Stefan Liebig: Also ich nehme keine große Bewegung wahr, vielleicht so ausgedrückt: Es gibt einzelne, denen das bewusst ist, auch gibt es einzelne Initiativen, aber in der Breite würde ich sagen, ja, ist es nicht wirklich ein Thema.
Kathrin Kühn: Handelt es sich dabei aber nicht auch um, ich sage einmal, wenn es eine historische Krise ist, ein vielleicht auch historisches wissenschaftliches Versagen, das dann nicht zu erkennen und breit zu debattieren und schnell zu handeln? Denn wir wissen ja alle: Strukturveränderungen brauchen Zeit, methodische Strukturveränderungen vielleicht sogar noch länger, wenn es um einen gesamten Kanon geht - müsste da jetzt nicht ein Ruck durch das Feld gehen?
Stefan Liebig: Ja, denke ich mir schon, aber ich würde auch so sagen: Die Anreize dafür tatsächlich etwas schnell zu ändern, sind relativ gering. Oder andersrum, man könnte das sicherlich noch mehr befeuern. Da derartige Dinge natürlich immer auch was mit Geld zu tun haben, auch Forschungsgelder, ist das auch - wenn wir genau darüber nachdenken, wie können wir tatsächlich schnell Daten auf den Weg bringen - ist das auch immer eine Frage, inwieweit Finanzmittel verfügbar sind, inwieweit auch Fördermittel sehr schnell aktiviert werden können.
Kathrin Kühn: Und hat es auch damit etwas zu tun, wo das Fach herkommt? Also dass das bisher nicht gefordert war, so dieses Wissen auch zu liefern; also abgesehen davon, dass es vielleicht heute auch noch nicht genug gefordert wird?
Stefan Liebig: Die Sozialwissenschaften haben ja in den 70er-Jahren eigentlich einen Aufstieg erfahren, genau vor dem Hintergrund: Der Idee, dass die Sozialwissenschaften dazu herhalten sollen oder beitragen sollen, die Gesellschaft zu verändern und die Gesellschaft auf den Weg in eine bessere Welt zu führen. Man hat relativ schnell Anfang der 70er-Jahre gemerkt, dass diese technokratische Vorstellung nicht wirklich greift. Aus meiner Sicht hat sich dann das Fach so ein bisschen auch vor dem Hintergrund und vor dem Hintergrund dieser Erfahrung etwas zurückgezogen und aus meiner Sicht vielleicht auch manchmal etwas sich bequem gemacht, indem man gesagt hat: Wir wollen keine Technokraten sein, wir wollen nicht die Ingenieure der Gesellschaft sein, weil wir das nicht können, oder weil es nicht geht. Und von daher, glaube ich, ist auch das allgemeine Bewusstsein, das Sozialwissenschaften tatsächlich etwas Wichtiges beitragen können und beitragen müssen, nicht wirklich so breit in den Disziplinen verankert.
Kathrin Kühn: Mich hat sehr beeindruckt, was mir jemand aus dem medizinischen Bereich, also aus dem Forschungsbereich da erzählt hat. Nämlich wenn er auf das Ringen der Sozialwissenschaften, der Fächer da, um Fördergelder schaut - wo es mal um eine halbe Million, mal um drei Millionen, vielleicht auch mal um zehn Millionen Euro geht - dass das so ein bisschen schockierend ist. Denn dort würde über ganz andere Summen gesprochen, also wenn es um Impfstoffforschung geht und ähnliches. Also zeigt sich das daran auch genau, dass es in den Sozialwissenschaften verhältnismäßig geringe Fördersummen gibt? Obwohl es ja um Themen geht: Wie kriegen wir Menschen durch eine Krise?
Stefan Liebig: Ja, absolut. Soweit ich mich erinnere, ist damals, zu Beginn der Pandemie, eine Förderinitiative für die Universitätsmedizin für 100 Millionen Euro auf den Weg gebracht worden. Die Fördersumme oder der Förderrahmen für die Sozialwissenschaften war deutlich geringer. Und das zeigt oder das ist eigentlich eine allgemeine Erfahrung, dass gerade im Bereich Medizin; im Bereich Ingenieurwissenschaften ganz andere Fördersummen gehandelt werden und es um ganz andere Volumen geht.
Kathrin Kühn: Jetzt könnte man ja dann darüber nachdenken, warum wird dieses Geld denn nicht gegeben? Also warum halten das dann Entscheidungsträgerinnen und -träger nicht für sinnvoll? Und dann kommen wir zu einem Punkt, das sagen wir mal, wenn eine Impfstoffentwicklung nicht so klappt oder eine medizinische Entwicklung oder etwas aus dem Ingenieurswissenschaften, dann fällt das nicht auf eine Politikerin, einen Politiker zurück. Aber wenn dort Wissen angefordert wird, was letztlich dann auch Parteipositionen beeinflusst, dann hat das da Folgen für das Handeln. Hat es damit zu tun, dass das eine sehr unbequeme Gemengelage ist?
Stefan Liebig: Das denke ich auch, vor allem auch deswegen, wenn ich mir das so anschaue, welche Funde wir ja auch haben zum Beispiel, was die Belastung durch den Klimawandel und die Verteuerung der Energie angeht. Die Ergebnisse, die wir haben, oder diese Erkenntnisse: Wer wird wie belastet und welche Effekte hat das, die stehen eigentlich schon seit längerem im Raum. Und trotzdem entscheidet sich die Politik für Maßnahmen, die bessergestellten Haushalten die gleiche Unterstützung zuteilwerden lässt - und das ist natürlich auch nachvollziehbar, warum das dann so passiert aufgrund von bestimmten Interessengruppen. Aber was man daran sieht ist: Auf der einen Seite gibt es diese Befunde und auf der anderen Seite er gibt es dann auch politische Gründe, diese Befunde eben nicht anzuwenden und die nicht in Politik umzuwenden; umzusetzen.
Kathrin Kühn: Müssten Forscherinnen und Forscher dann jetzt mit breiterer Brust darauf hinweisen?
Stefan Liebig: Ja, eigentlich müssten die Sozialwissenschaften viel selbstbewusster auftreten. Das wird auch daran sichtbar, wenn man – Sie hatten vorhin die Fördersummen in der Medizin genannt -, wenn man die Fördersummen für die großen Umfragen in Deutschland, sozioökonomische Panel, auch andere Studien anschaut, dann ist es tatsächlich ein Bruchteil dessen, was für die anderen Disziplinen investiert wird. Und da glaube ich auch, dass die Sozialwissenschaften ja gleichsam zu scheu sind, um tatsächlich größere Summen auch einzufordern.
Kathrin Kühn: Hat sich das Feld dieses Grab vielleicht auch ein wenig selbst geschaufelt? Ich spreche jetzt eine Methodik-Diskussion an, die es zurzeit gibt, und zwar angefeuert hat das die britische Soziologin Monika Krause mit ihrem Buch „Model Cases“. Darin wirft sie den Sozialwissenschaften vor, zu viel anhand von Fallstudien zu arbeiten und daraus zu verallgemeinern. Und das kann ja vielleicht auch einen Anteil daran haben, dass es ein Image gibt, dass die Sozialwissenschaften eben nicht sozusagen verallgemeinerbares breites Wissen anliefern. Gibt es eine Methodik-Lücke? Gibt es da zu wenig Fortschritt? Und hat man sozusagen selbst zu seinem Image so beigetragen?
Stefan Liebig: Na ja, was die Kollegin aus Großbritannien den Sozialwissenschaften ja auch vorwirft, ist, dass sie im Prinzip beständig die alten Pfade beforscht, also sich auf alten Pfaden bewegt; wir sozusagen bestimmte Themen, die wir haben, beständig beforschen. Und dass diese Dinge, die sozusagen jenseits der ausgetretenen Wege sind, nicht hinreichend mitbedacht und mitbeforscht werden. Und da in dieser Kritik, da gehe ich vollkommen mit ihr überein. Zum Beispiel gibt es in den Sozialwissenschaften seit einigen Jahren die sogenannte Katastrophenforschung; Katastrophensoziologie. Das ist ein Forschungsfeld, wo wir jetzt erkennen, dass wenn wir dieses Feld besser bearbeitet hätten, wir da viel sprechfähiger wären in der aktuellen Situation.
Stefan Liebig: Nun, die Pandemie war eigentlich der Aufhänger dafür oder war der Impuls. Die Pandemie war der Impuls, über genau derartige Dinge nachzudenken. Ich bin mir da nicht wirklich sicher, ob wir viel gelernt haben. Es gibt einige Initiativen, die vor dem Hintergrund auch darüber nachgedacht haben, wie wir schneller an Forschungsdaten in derartigen Krisensituationen kommen, vor allem auch qualitätsgesicherten Forschungsdaten, die dann auch in die politischen Prozesse und Entscheidungsprozesse mit einfließen können.
Kathrin Kühn: Und hat das schon das gesamte Fach durchdrungen? Verspüren Sie sozusagen Erdbebenwellen, dass da der Wille ist, etwas zu ändern?
Stefan Liebig: Also ich nehme keine große Bewegung wahr, vielleicht so ausgedrückt: Es gibt einzelne, denen das bewusst ist, auch gibt es einzelne Initiativen, aber in der Breite würde ich sagen, ja, ist es nicht wirklich ein Thema.
Kathrin Kühn: Handelt es sich dabei aber nicht auch um, ich sage einmal, wenn es eine historische Krise ist, ein vielleicht auch historisches wissenschaftliches Versagen, das dann nicht zu erkennen und breit zu debattieren und schnell zu handeln? Denn wir wissen ja alle: Strukturveränderungen brauchen Zeit, methodische Strukturveränderungen vielleicht sogar noch länger, wenn es um einen gesamten Kanon geht - müsste da jetzt nicht ein Ruck durch das Feld gehen?
Stefan Liebig: Ja, denke ich mir schon, aber ich würde auch so sagen: Die Anreize dafür tatsächlich etwas schnell zu ändern, sind relativ gering. Oder andersrum, man könnte das sicherlich noch mehr befeuern. Da derartige Dinge natürlich immer auch was mit Geld zu tun haben, auch Forschungsgelder, ist das auch - wenn wir genau darüber nachdenken, wie können wir tatsächlich schnell Daten auf den Weg bringen - ist das auch immer eine Frage, inwieweit Finanzmittel verfügbar sind, inwieweit auch Fördermittel sehr schnell aktiviert werden können.
Kathrin Kühn: Und hat es auch damit etwas zu tun, wo das Fach herkommt? Also dass das bisher nicht gefordert war, so dieses Wissen auch zu liefern; also abgesehen davon, dass es vielleicht heute auch noch nicht genug gefordert wird?
Stefan Liebig: Die Sozialwissenschaften haben ja in den 70er-Jahren eigentlich einen Aufstieg erfahren, genau vor dem Hintergrund: Der Idee, dass die Sozialwissenschaften dazu herhalten sollen oder beitragen sollen, die Gesellschaft zu verändern und die Gesellschaft auf den Weg in eine bessere Welt zu führen. Man hat relativ schnell Anfang der 70er-Jahre gemerkt, dass diese technokratische Vorstellung nicht wirklich greift. Aus meiner Sicht hat sich dann das Fach so ein bisschen auch vor dem Hintergrund und vor dem Hintergrund dieser Erfahrung etwas zurückgezogen und aus meiner Sicht vielleicht auch manchmal etwas sich bequem gemacht, indem man gesagt hat: Wir wollen keine Technokraten sein, wir wollen nicht die Ingenieure der Gesellschaft sein, weil wir das nicht können, oder weil es nicht geht. Und von daher, glaube ich, ist auch das allgemeine Bewusstsein, das Sozialwissenschaften tatsächlich etwas Wichtiges beitragen können und beitragen müssen, nicht wirklich so breit in den Disziplinen verankert.
Kathrin Kühn: Mich hat sehr beeindruckt, was mir jemand aus dem medizinischen Bereich, also aus dem Forschungsbereich da erzählt hat. Nämlich wenn er auf das Ringen der Sozialwissenschaften, der Fächer da, um Fördergelder schaut - wo es mal um eine halbe Million, mal um drei Millionen, vielleicht auch mal um zehn Millionen Euro geht - dass das so ein bisschen schockierend ist. Denn dort würde über ganz andere Summen gesprochen, also wenn es um Impfstoffforschung geht und ähnliches. Also zeigt sich das daran auch genau, dass es in den Sozialwissenschaften verhältnismäßig geringe Fördersummen gibt? Obwohl es ja um Themen geht: Wie kriegen wir Menschen durch eine Krise?
Stefan Liebig: Ja, absolut. Soweit ich mich erinnere, ist damals, zu Beginn der Pandemie, eine Förderinitiative für die Universitätsmedizin für 100 Millionen Euro auf den Weg gebracht worden. Die Fördersumme oder der Förderrahmen für die Sozialwissenschaften war deutlich geringer. Und das zeigt oder das ist eigentlich eine allgemeine Erfahrung, dass gerade im Bereich Medizin; im Bereich Ingenieurwissenschaften ganz andere Fördersummen gehandelt werden und es um ganz andere Volumen geht.
Kathrin Kühn: Jetzt könnte man ja dann darüber nachdenken, warum wird dieses Geld denn nicht gegeben? Also warum halten das dann Entscheidungsträgerinnen und -träger nicht für sinnvoll? Und dann kommen wir zu einem Punkt, das sagen wir mal, wenn eine Impfstoffentwicklung nicht so klappt oder eine medizinische Entwicklung oder etwas aus dem Ingenieurswissenschaften, dann fällt das nicht auf eine Politikerin, einen Politiker zurück. Aber wenn dort Wissen angefordert wird, was letztlich dann auch Parteipositionen beeinflusst, dann hat das da Folgen für das Handeln. Hat es damit zu tun, dass das eine sehr unbequeme Gemengelage ist?
Stefan Liebig: Das denke ich auch, vor allem auch deswegen, wenn ich mir das so anschaue, welche Funde wir ja auch haben zum Beispiel, was die Belastung durch den Klimawandel und die Verteuerung der Energie angeht. Die Ergebnisse, die wir haben, oder diese Erkenntnisse: Wer wird wie belastet und welche Effekte hat das, die stehen eigentlich schon seit längerem im Raum. Und trotzdem entscheidet sich die Politik für Maßnahmen, die bessergestellten Haushalten die gleiche Unterstützung zuteilwerden lässt - und das ist natürlich auch nachvollziehbar, warum das dann so passiert aufgrund von bestimmten Interessengruppen. Aber was man daran sieht ist: Auf der einen Seite gibt es diese Befunde und auf der anderen Seite er gibt es dann auch politische Gründe, diese Befunde eben nicht anzuwenden und die nicht in Politik umzuwenden; umzusetzen.
Kathrin Kühn: Müssten Forscherinnen und Forscher dann jetzt mit breiterer Brust darauf hinweisen?
Stefan Liebig: Ja, eigentlich müssten die Sozialwissenschaften viel selbstbewusster auftreten. Das wird auch daran sichtbar, wenn man – Sie hatten vorhin die Fördersummen in der Medizin genannt -, wenn man die Fördersummen für die großen Umfragen in Deutschland, sozioökonomische Panel, auch andere Studien anschaut, dann ist es tatsächlich ein Bruchteil dessen, was für die anderen Disziplinen investiert wird. Und da glaube ich auch, dass die Sozialwissenschaften ja gleichsam zu scheu sind, um tatsächlich größere Summen auch einzufordern.
Kathrin Kühn: Hat sich das Feld dieses Grab vielleicht auch ein wenig selbst geschaufelt? Ich spreche jetzt eine Methodik-Diskussion an, die es zurzeit gibt, und zwar angefeuert hat das die britische Soziologin Monika Krause mit ihrem Buch „Model Cases“. Darin wirft sie den Sozialwissenschaften vor, zu viel anhand von Fallstudien zu arbeiten und daraus zu verallgemeinern. Und das kann ja vielleicht auch einen Anteil daran haben, dass es ein Image gibt, dass die Sozialwissenschaften eben nicht sozusagen verallgemeinerbares breites Wissen anliefern. Gibt es eine Methodik-Lücke? Gibt es da zu wenig Fortschritt? Und hat man sozusagen selbst zu seinem Image so beigetragen?
Stefan Liebig: Na ja, was die Kollegin aus Großbritannien den Sozialwissenschaften ja auch vorwirft, ist, dass sie im Prinzip beständig die alten Pfade beforscht, also sich auf alten Pfaden bewegt; wir sozusagen bestimmte Themen, die wir haben, beständig beforschen. Und dass diese Dinge, die sozusagen jenseits der ausgetretenen Wege sind, nicht hinreichend mitbedacht und mitbeforscht werden. Und da in dieser Kritik, da gehe ich vollkommen mit ihr überein. Zum Beispiel gibt es in den Sozialwissenschaften seit einigen Jahren die sogenannte Katastrophenforschung; Katastrophensoziologie. Das ist ein Forschungsfeld, wo wir jetzt erkennen, dass wenn wir dieses Feld besser bearbeitet hätten, wir da viel sprechfähiger wären in der aktuellen Situation.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.