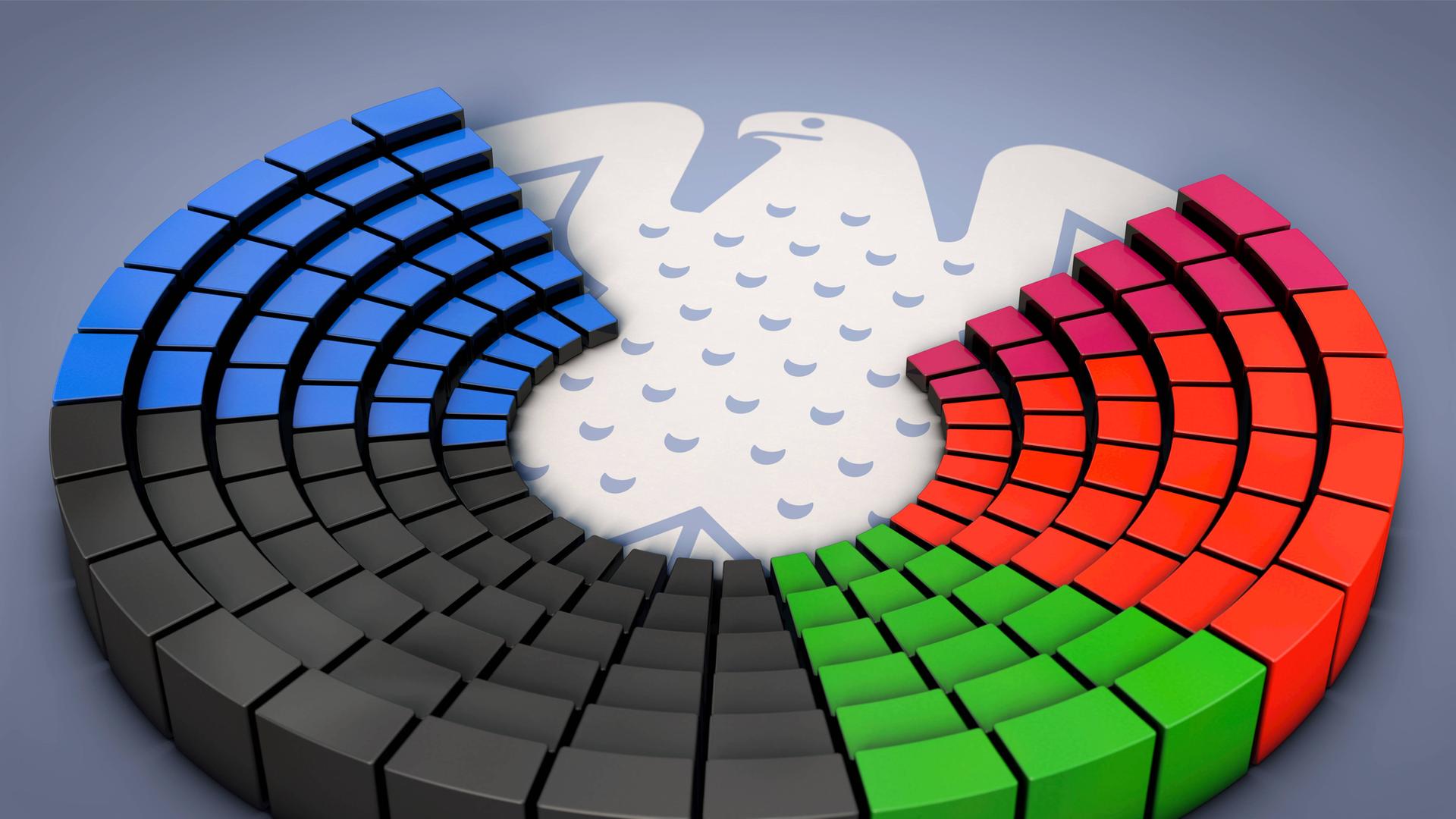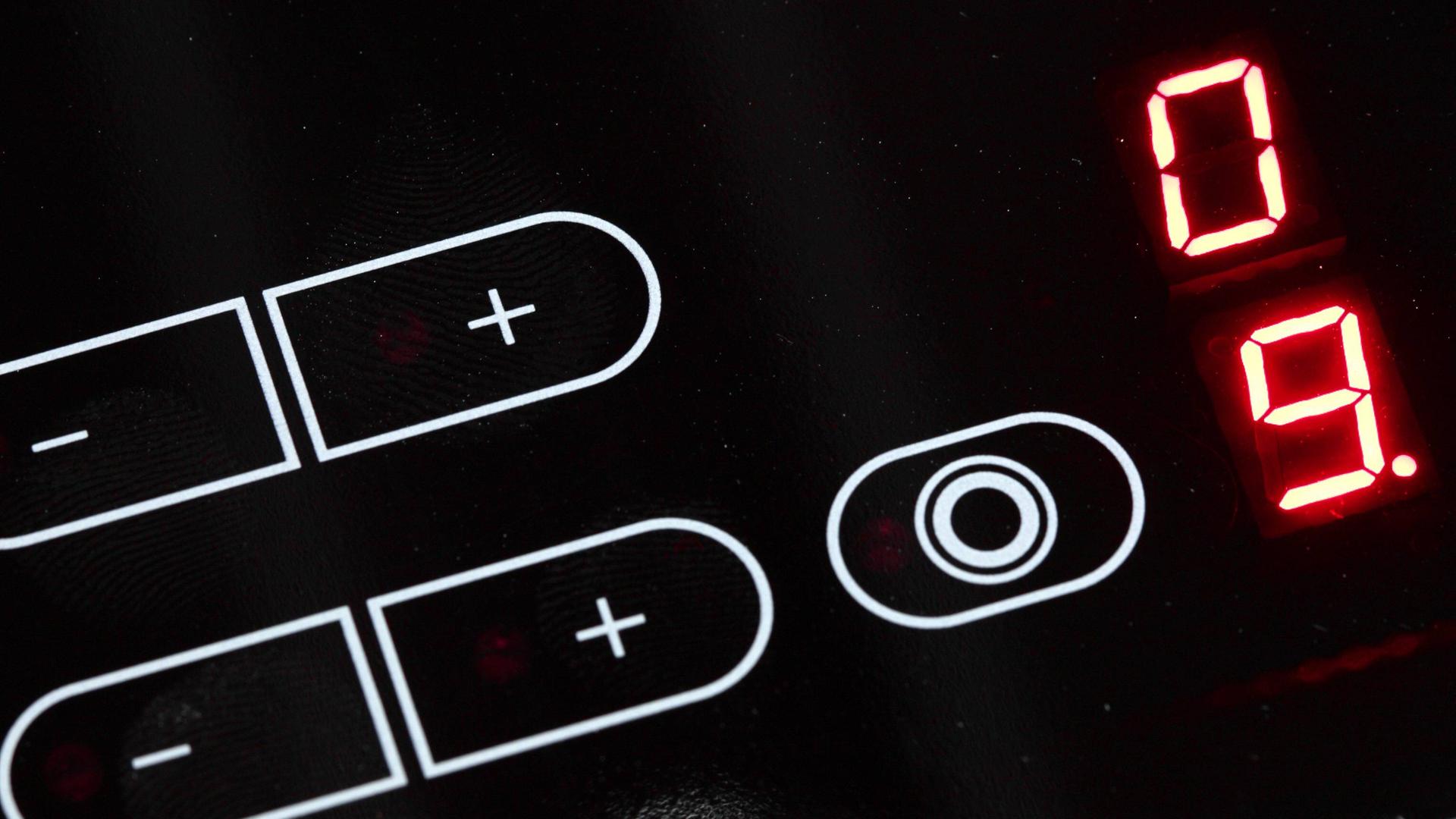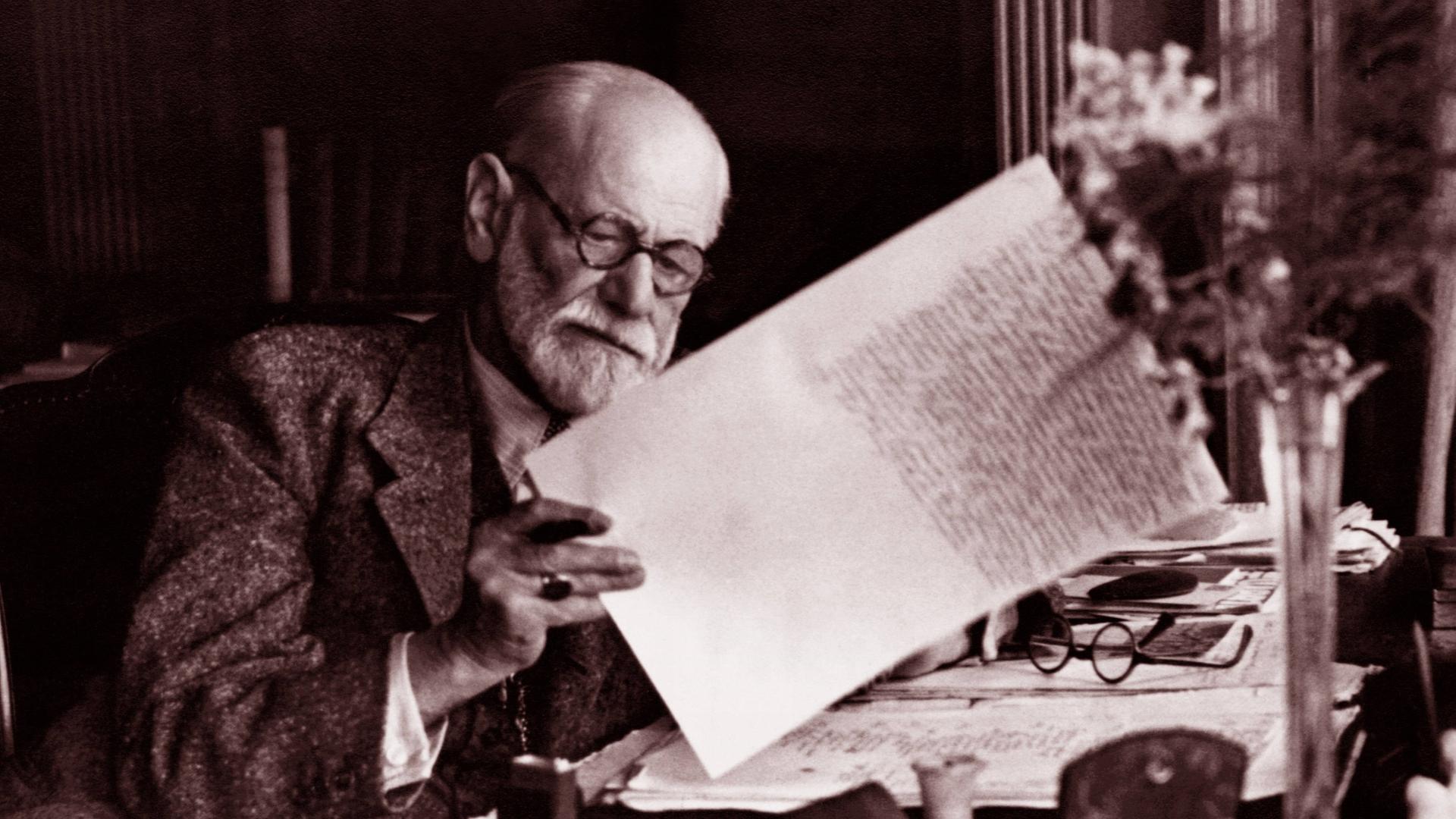Mein wiederkehrender, ganz realer Alptraum ist, dass ich zu einem gesellschaftlichen Anlass eingeladen bin und es wieder kein Bier gibt. Ich mag nun einmal keinen Wein. Und ich liebe Bier. Aber als Frau wird man schräg angeschaut, wenn man ein rustikales Bier den vermeintlich edleren Getränken vorzieht. Frauen und Bier, das passt nicht. Das Bier als Getränk wird heute mehr denn je männlich gelesen. Das zeigt schon die Werbung, die das Bier zumeist im Kontext maskuliner Sportarten und männerbündlerischer Rituale ansiedelt: „Auf die Freundschaft”, „Heute ein König”.
Kein Wunder, dass der Bierabsatz in Deutschland seit einem kurzen Peak nach der Wiedervereinigung kontinuierlich zurück geht, wenn man mehr als die Hälfte der Bevölkerung ignoriert und vor den Kopf stößt. Das stimmt zwar nicht ganz, denn die Branche stemmt sich gegen den Niedergang, indem sie verfestigten Klischées folgend Leichtbiere, Biermischgetränke, sogenannte „Mädchenbiere” auf den Markt wirft.
Kürzlich hat die französische Brauerei Kronenbourg eine Art „Model-Bier” kreiert und versucht, es mittels massivem Marketing und teuren Influencerinnen-Kampagnen in den Markt zu drücken: 1664 blanc. Kein Mensch braucht das. Genau so wenig wie die abgefahrenen und ausgedachten Craftbeer-Sorten von neu gegründeten Microbreweries, die mit viel Bohei in den neu entstandenen Bierbars in großstädtischen Szenequartieren oder von Bier-Sommeliers in Hipster- und Feinschmecker-Restaurants ausgeschenkt werden. Meist handelt es sich dabei um eine herausfordernd bittere , fast ungenießbare trübe Plörre mit viel zu viel Stammwürze und blumiger Hefe, die unfiltriert im Glas herum schwimmt.
Ich bin in Fürth aufgewachsen, das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen großen Ruf als Bierstadt hatte. Als Grundschulkinder liefen wir vorbei an imposanten Brauereien, deren Hefegeruch in der Luft lag. In der Gegend gibt es bis heute die größte Vielfalt kleiner unabhängiger Brauereien , die allesamt in bester handwerklicher Tradition ein hervorragendes Helles brauen, ohne es Craftbeer oder sich selbst Microbrewery zu nennen. Manche Dinge kann man nicht und muss man nicht verbessern, man muss sie nur pflegen.
Es gibt vielleicht kein feministisches Bier (Ausnahme: „Muschikraft” aus Wien, „das feministische Craftbeer von Frauen für Frauen”), aber Bier ist ein Thema für Feministinnen oder sollte es zumindest sein. Bier ist zu wichtig, um es den Männern zu überlassen. Genauso wenig wie das Biertrinken Männersache ist, ist es das Bierbrauen. Traditionell, über Jahrtausende, war das Bierbrauen wie das Brotbacken ein ganz normaler Teil der hauswirtschaftlichen Tätigkeit und wurde somit vom weiblichen Teil absolviert. Auch das Wissen darüber wurde demnach in matriarchaler Linie weitergegeben von Mutter zu Tochter. Erst mit der Industrialisierung und Verwissenschaftlichung des Brauwesens wurde das Bier zur Männerdomäne.
Männliches Expertentum in der arbeitsteiligen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft drängte die Frauen aus dem Feld. Das ändert sich langsam, aber gewaltig: Seit kurzem drängen immer mehr Frauen in die Studiengänge für Brauereiwesen, immer öfter sind es die Töchter, die familiengeführte Brauereien übernehmen und in einer Kombination aus handwerklicher Tradition und zeitgemäßem Marketing geschickt modernisieren wie Brlo aus Berlin.
Annette Walter, Jahrgang 1978, ist Journalistin, hat ein Studium der Journalistik und Politikwissenschaft an der Universität Leipzig absolviert und bisher für den Bayerischen Rundfunk, die taz, das Goethe-Institut und Jungle World gearbeitet. Mit dem IJP-Stipendium war sie längere Zeit in London und interessiert sich seitdem besonders für britische Popkultur.
Es passierte mir vor einiger Zeit bei einem Dinner. Die Gäste trugen Anzug und kleines Schwarzes, die Menükarte war auf edlem Papier gedruckt, die Atmosphäre elegant. Ich blätterte durch die Weinempfehlungen, fand kein passendes Getränk, überlegte einen Moment – und sagte dann: „Für mich bitte ein Bier.“ Mein Tischnachbar scherzte: „Ach, heute mal was Rustikales zum Heilbutt?“ Der Kellner fragte, ob ich den Wein dann zum Hauptgang serviert haben möchte. „Das Bier bitte zum Hauptgang, aber bitte ohne Chardonnay“, antwortete ich unverblümt.
Ja, ich meinte Bier. Goldgelb, leicht gekühlt, mit luftigem Schaum. Ich meinte den malzigen Duft, die herbe Frische, das Gluckern im Glas. Ich meinte die Befreiung von der Etikette, die vorsieht, dass eine Frau zu einem Fisch in Safranschaum selbstverständlich einen Grauburgunder trinkt. Ich meinte, was ich sagte.
Mein wiederkehrendes Erlebnis ist, dass ich zu einem gesellschaftlichen Anlass, einer Kunst-Vernissage, einer Geburtstagseinladung oder einer Wohnungseinweihungsparty erscheine und es wieder kein Bier gibt. Vorausschauend bin ich dazu übergegangen, mir vorher zwei Flaschen in der Handtasche zu verstauen. Ich bin nun einmal bekennende Weinbanausin. Und ich liebe Bier. Diese höflich gemeinte Geste kommt nicht immer gut an. Bisweilen wurde dies als Geringschätzung der Getränkeauswahl des oder der Gastgeberin verstanden. Für mich sichert es dagegen einen gelungenen Abend.
Als Frau wird man ab und zu gefragt, warum man das ehrliche Bier den vermeintlich edleren Getränken vorzieht. Was ist denn mit der los? Es fällt auf und gilt als ungewöhnlich. Einen großen Anteil daran hat sicher das Klientel, das solche Veranstaltungen besucht, Akademikerinnen und Akademiker, Kunstsinnige, Bohemiens, Kulturschaffende – es sind Zirkel, in denen Bier nicht den Spitzenplatz der alkoholischen Getränke besetzt, wobei Rosé, Crémant und Grauburgunder als Konsensgetränke nach meiner Beobachtung von 95 Prozent aller Menschen, mit denen ich dort Konversation betreibe, mit Wohlgefallen konsumiert werden und Fachgespräche über Qualität und Jahrgang auslösen. Weinkenntnisse gelten als anspruchsvoll, Bier als etwas Kaltes und Nasses, das man hinunterstürzt. Das Getränk des Proletariats. Man ist ja schließlich nicht im Fußballstadion!
Schon in einem Standardwerk der kultivierten Trinkerlektüre, Anständig trinken von Kingsley Amis von 1972, worin es ausführlich um das Mixen von Martini-Cocktails oder Old Fashioneds, die Bestandteile eines wohlsortierten Schnapsregals und spontane Weingedanken ging, fehlt ein längerer Absatz über Bier, denn das schmäht Amis als „Getränk der Landbevölkerung“.
Die Rezeption von Bier verdeutlicht bis heute Unterschiede zwischen sozialen Schichten. Speziell mit der Popularität von Craft Beer werden gesellschaftliche Klassengrenzen keineswegs abgebaut, nein, die Gräben werden tiefer. Denn dieses generell teurere und affektierte Gebräu ist erdacht für die Neue Mittelklasse, wie sie der Soziologe Andreas Reckwitz treffend charakterisiert: Die Singularisierung des Profanen, das den Lebensstil dieses Milieus charakterisiert, macht natürlich auch vor Bier nicht Halt. Mit dem Konsum von Craft Beer wird Profanes in Außergewöhnliches ästhetisiert und zum Distinktionsmerkmal – „Ist halt eine kleine Privatbauerei, da weiß jeder noch, wo der Hopfen wächst, alles Handarbeit“ und so weiter und so weiter. Für diese Klasse sind diese Praktiken von herausgehobener, gewissermaßen stilbildender Bedeutung, eben auch das richtige Getränk. Doch zum Bohei um Craft Beer komme ich später.
Denn unabhängig von der Klasse wird weiblicher und männlicher Bierkonsum anders gelesen. Gibt es auf den Getränkekarten oder Tafeln von Bars und Restaurants gar ein unsichtbares Schild „Empfehlung für Männer“ oder „Empfehlung für Frauen“, was die Gäste so internalisiert haben, dass sie es gar nicht mehr hinterfragen und ihre Bestellung eines Getränks für eine freie Wahl halten? Ist es eine genderspezifische Entscheidung? Ich meine, ja. Warum lesen wir Crémant als femininen Drink, während ein Weizenbier männlich konnotiert ist? – Auch oder gerade weil es diese französische Frauenstimme war, die in einer Werbung den Mann an „diese Bier“ erinnert, „die so schön hat geprickelt in meine Bauchnabel“. Gemeint war Schöfferhofer Weizen, getrunken hat es natürlich der Mann. Ist es aber überhaupt politisch korrekt, ein Getränk einem Geschlecht zuzuordnen, denn mittlerweile leben wir ja im post-binären Zeitalter? Geht es bei der Unterscheidung zwischen männlichen und weiblichen Getränken vor allem um männliche Kontrolle? Ich bin überzeugt davon, dass der Konsum von Bier bestehende Geschlechterordnungen und Machtverhältnisse reproduziert. Im Bierkonsum lassen sich patriarchale und heteronormative Machtstrukturen entlarven. Der soziokulturelle Umgang mit Bier wird von der sozialen Geschlechtszugehörigkeit determiniert.
Bierkonsum ist eine Kulturtechnik. Mich interessiert, warum sie im Jahr 2025 noch unter der Kontrolle der Männer steht und wie es dazu kam. Inwiefern etabliert diese Kulturtechnik ein Machtsystem, das die maskuline Dominanz in der Gesellschaft sichert?
Bei dem französischen Soziologen Pierre Bourdieu heißt es dazu im Klassiker Die feinen Unterschiede: „Dem Mann steht es zu, mehr und ‚Stärkeres’ zu trinken und zu essen. So wird beim Apéritif dem Mann auch zweimal gereicht (um so mehr, wenn gefeiert wird), die großen Gläser bis zum Rand voll (der Erfolg von Pernod und Ricard ist sicherlich wesentlich darin begründet, dass es sich dabei um ein zugleich starkes und ergiebiges Getränk handelt – kein Fingerhütchen).“ Der Frau das Fingerhütchen, dem Mann der Maßkrug? Sicherlich ist diese Vorstellung von 1979 überholt. Verschwunden ist sie unterschwellig indes nicht. Nach Bourdieu ist das Kulturelle – auch beim Essen und Trinken – nichts Autonomes oder Spontanes, sondern das Ergebnis einer bestimmten Sozialisation. Mit der Etablierung von Geschmacksrichtungen zeigen sich soziale Unterschiede in einer Gesellschaft. Getränkepräferenzen, die Wahl von Schnaps, Bier, Wein oder Drinks, sind immer durch die kulturelle Herkunft, Alter, Geschlecht und Klassenzugehörigkeit beeinflusst.
Frauen und Bier, das ist keine konfliktfreie Beziehung, keine romantische Liebesehe, sondern bisweilen noch immer ein holpriges Arrangement. Bier als Getränk wird immer noch männlich gelesen. Schuld daran ist vor allem die Werbung, die das Bier zumeist im Kontext maskuliner Sportarten und männerbündlerischer Rituale ansiedelt: „Auf die Freundschaft” oder „Heute ein König” heißt es dann.
Bierwerbung richtet sich immer noch in erster Linie an Männer. Die Studie Bier ist ein Männergetränk von Jennifer Hutchins im International Journal of Advertising untersuchte bereits 2014 den Zusammenhang zwischen Bierkonsum und Männlichkeit in Großbritannien. Die Autorin ging der Frage nach, wie Werbung und kulturelle Normen Bier als Getränk für Männer darstellen und so Wahrnehmung und Konsumverhalten massiv beeinflussen. Die Studie analysiert, wie sich diese geschlechtsspezifischen Darstellungen auf die Beziehung von Männern und Frauen zu Bier auswirken. Laut ihrer Betrachtung ist Bier ein Symbol für Männlichkeit, Kameradschaft und Machotum. Viele Werbekampagnen zeigen Männer, die Bier genießen und dabei „männlichen“ Aktivitäten wie Sportschauen, Grillen oder Abhängen mit anderen Männern nachgehen. Im Gegensatz dazu werden Frauen in diesen Anzeigen oft entweder als passive Beobachter oder als attraktive Elemente dargestellt, die das männliche Publikum ansprechen sollen. Diese durchgängige und allgegenwärtige Darstellung hat subtil, oft aber auch weniger subtil, die Vorstellung in unser kollektives Bewusstsein eingeprägt, dass Bier untrennbar mit Männlichkeit verbunden sei. Der Slogan „Beck's löscht Männerdurst“, der im Jahr 1955 eingeführt wurde, wurde immerhin 20 Jahre später in „Beck's löscht Kenner-Durst“ geändert.
Bierproduzenten haben immer wieder versucht, mit ihren Kampagnen Frauen zu adressieren. 1977 kämpfte Guinness mit sinkenden Umsätzen und erdachte eine weitere Marketingstrategie, um junge Frauen anzusprechen. „Jede Frau sollte einen kleinen schwarzen Drink zu sich nehmen“, stand über dem Foto einer an eine Nouvelle-Vague-Schönheit erinnernde jungen Frau. Die Botschaft lautete: „Guinness ist ein schönes, interessantes Getränk, das von netten, interessanten Frauen getrunken wird.“ Im Gegensatz dazu richteten sich Marketing-Geschichten rund um Wein und Cocktails meist stärker an Frauen und ihre Wahl wurde als anspruchsvoll, stilvoll und feminin gewürdigt.
Kürzlich hat die französische Brauerei Kronenbourg eine Art „Model-Bier“ kreiert und versucht, es mittels massivem Marketing und teuren Influencerinnen-Kampagnen in den Markt zu drücken. „1664 blanc“ wird in kleinen blauen Flaschen verkauft und enthält Aromen von Orangenschale, exotischen Früchten und Gewürzen. Erste Assoziation: Mineralwasser. Ein Bier, das man elegant trinken soll. Das letztlich aber in der Nische versickert.
Doch Gender-Marketing geht sowieso oft nicht auf. Eine Studie um die US‑Wissenschaftlerin Leslie K. John an der Harvard Business School hat untersucht, warum es in der Regel genau die Menschen abschreckt, die ein Unternehmen ansprechen möchte. Tatsächlich fühlen sich Frauen durch Geschlechter-Labels stärker unter Druck gesetzt als Männer, da Frauen seit langem durch negative Stereotypen an den Rand gedrängt werden und daher empfindlicher auf Marketing‑Maßnahmen reagieren, die sie in eine Schublade stecken wollen, behauptet das Forschungsteam.
Ein dezidiert feministisches Branding schließt wiederum viele Zielgruppen aus. Aus Brasilien gibt es in diesem Segment das „Cerveja Feminista“. Aus der feministischen Craftbeer-Szene aus Wien stammt „Muschikraft“ – ein Versuch, mit einem frechen Namen Aufmerksamkeit zu erregen. Deren Jingle klingt dann entsprechend edgy: „Es ist eigentlich unglaublich, dass im Jahr 2025 Bier immer noch als das Männergetränk vermarktet wird. Genau mit diesem Klischee räumt Muschikraft Bier jetzt auf – weil Bier ist für alle da, Oida! Muschikraft! Das intersektional-feministische Bio-Craft-Bier aus Wien. Ein köstliches Bier für viele Geschmäcker und alle Geschlechtsidentitäten! Patriarchale Strukturen beim Biertrinken reflektieren.“ Die Künstlerin Anna Sophie Tschannett ist die Erfinderin. Sie ist der Überzeugung, dass „Bier gesamtgesellschaftlich immer noch stark männlich konnotiert ist“. Seit der Gründung ihrer Marke wurde sie mit misogynen Anfeindungen konfrontiert. Interessanterweise nicht nur von Männern, sondern auch von einigen Frauen. „Viele Frauen empfanden den Namen als despektierlich, vulgär und sexistisch.“, sagt sie.
Muss man ein Bier tatsächlich, um das Hopfengetränk als feministisch auszuweisen, mit dem Wort für das weibliche Geschlechtsteil, die Vulva, benennen? Ich bin der Meinung, es darf ruhig subtiler gehen. Auf dem Etikett ist in stilisierter Form eine Zeichnung einer Vulva abgebildet, ein mittlerweile omnipräsentes und inflationär verwendetes Symbol für vermeintlich rebellischen Feminismus. Also ob sich das noch irgendwie skandalisieren ließe. Gespannt teste ich eine Flasche Muschikraft, um zu erschmecken, wie ein feministisch gebrandetes Bier schmeckt. Nicht außergewöhnlich, aber durchaus trinkbar. Für einen europaweiten Vertrieb außerhalb Wiens und Österreich ist „Muschikraft“ natürlich viel zu speziell und nischig. Niemand würde in der Schumanns Bar in München oder der Paris Bar in Berlin ein Bier mit diesem Namen auf die Karte setzen. Es ist und bleibt ein Nischenphänomen.
Es gab stets eine starke Verbindung zwischen männlich besetzten Sportarten und Bier. Kein Fußballstadionbesuch ohne Plastikbierbecher in der Hand, wenn man seinem eigenen Verein zujubelt. Nicht zufällig bewerben Bierfirmen Fußballereignisse besonders gern als Sponsoren. Bier und Fußball sind seit jeher eine untrennbare Allianz.
Kein Wunder, dass der Bierabsatz in Deutschland seit einem kurzen Peak nach der Wiedervereinigung kontinuierlich sinkt, wenn man mehr als die Hälfte der Bevölkerung ignoriert und vor den Kopf stößt. Im ersten Halbjahr 2025 ging der Bierabsatz um 5,6 Prozent zurück, so stark wie schon lange nicht mehr.
Andererseits stimmt das aber nicht ganz, denn die Branche stemmt sich gegen den Niedergang, indem sie verfestigten Klischées folgend Leichtbiere, Biermischgetränke, sogenannte „Mädchenbiere” auf den Markt wirft.
In den 1990er-Jahren haben wir Augustiner in München getrunken. Warum? Weil die Marke strikt auf männlich konnotierte Werbung verzichtete und allein durch Mundpropaganda in den Clubs bekannt wurde. Bis uns dann das erste „Mädchenbier“ vorgesetzt wurde, was wir auch gern konsumierten. Pionier beim Thema Frauenbier war Beck’s Gold, das seit dem Sommer 2002 in Bars und Restaurants deutschlandweit ausgeschenkt wurde. Schnell entwickelte es sich in meinem damaligen studentischen Umfeld in den Clubs in Leipzig zur Lieblingswahl für mich und meine Freundinnen. Die einen hielten es im positiven Sinn für ein mildes Bier, Verächter schmähten es als wässriges Dünnbier. Das Hopfenaroma ist minimal, eher erinnert es an eine Limonade mit einem Schuss Bier. Auch die Farbe ist wie der Name sagt tatsächlich golden, also heller und kristalliger als herkömmliches Bier, und das in weißer statt in grüner oder brauner Flasche. „Frauen an die Flasche“ titelte die taz damals und es klang nicht gerade besonders feministisch. Der Konzern wollte allerdings keineswegs in den Verdacht geraten, nur die weibliche Kundschaft ansprechen zu wollen und damit unter dem Verdacht der Misogynie zu stehen. Die Brauerei betonte stattdessen, man wolle „aktive, weltoffene Konsumenten“ ansprechen. Werbemäßig hat sich jüngst einiges verändert, etwa mit der europaweiten Love-Beer-Kampagne, die Frauen auf den Plakaten zeigt.
In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich zunächst in den USA, später auch in Deutschland, eine aktive Craft Beer-Szene entwickelt. Dadurch stieg zwar auch der Anteil von Frauen im Brauwesen. Das Herstellen von Craft Beer ist für eine Mehrzahl an Frauen also attraktiver als das Brauen von herkömmlichem Bier. Craft Beer gilt als kreativer und inklusiver. Frauen experimentieren also durchaus gern als Gypsy‑Brauerinnen, gründen Craft Beer Logdes, nippen als Bier-Sommelières an unterschiedlichen Sorten.
Mir persönlich ist das aber zu prätentiös, denn keiner oder keine muss bei einer großen vorhandenen Brauereidichte neue eröffnen, sondern die bestehenden weiterführen. Kein Mensch braucht die abgefahren und überteuerten Craft Beer‑Sorten von neu gegründeten Microbreweries, die mit viel Aplomb und Tamtam in den neu entstandenen Bierbars in großstädtischen Szenequartieren oder von Bier-Sommeliers in Hipster- und Feinschmecker-Restaurants ausgeschenkt werden. Meist handelt es sich dabei um eine herausfordernd bittere, fast ungenießbare trübe Flüssigkeit mit viel zu viel Stammwürze und blumiger Hefe, die unfiltriert im Glas schwimmt.
Mir missfällt bereits das Wort Craft Beer. Craft bedeutet Handwerk. Beer heißt Bier. Es handelt sich also um ein handwerklich hergestelltes Bier, wodurch man eine Überlegenheit gegenüber anderen Bierkategorien herstellt. Manufactum versus Kaufhof. Aber ist Bierbrauen ja nicht immer ein Handwerk? Auch bei der Herstellung von Craft Beer rührt doch kein Brauer oder keine Brauerin mit einem großen Löffel in einer Wanne.
Warum also das Interesse von Frauen an Craft Beer? Ich komme aus Franken, wo es bis heute die größte Vielfalt kleiner unabhängiger Brauereien gibt, die allesamt in bester handwerklicher Tradition ein hervorragendes Helles brauen, ohne dass es Craft Beer oder Microbrewery heißt. Manche Dinge kann man nicht und muss man nicht verbessern oder innovieren, man muss sie nur pflegen. In dieser Gegend gibt es wegen der Brauereidichte und demographiebedingt immer mehr weiblich geführte Brauereien. Eine der Inhaberinnen des sogenannten Ammerndorfer Bieres wurde gefragt, ob es ein Frauen-Bier gibt. Sie antwortet mit der Gegenfrage: „Wo steht geschrieben, dass das Produkt Bier nur für Männer ist? Im Prinzip ist jede Biersorte auch etwas für Frauen.“ Frauen als Geschäftsführerinnen – auch bundesweit gibt es immer Frauen in der Branche, etwa bei Warsteiner.
In den USA ist die Craft-Brauerinnen-Szene sichtbarer als in anderen Ländern. Die Brauerei Monkish aus Los Angeles stellt etwa Bier mit dem Namen „Feminist“ her. Hurray’s Girl Beer wirbt mit dem Slogan „Nicht wie die anderen“. Es gibt die Sorten Blaubeer-Lavendel und Ananas. Der Dokumentarfilm The Love of Beer von 2011 der Regisseurin Alison Grayson thematisierte eben dieses Phänomen und würdigte die Frauen der Craft Beer Szene rund um Portland und Seattle. Der Mumblecore-Film Drinking Buddies von 2013 spielt natürlich in einer Craft Brauerei in Chicago.
Laut einer Studie der Universität Stanford von 2019 spielt das Geschlecht des Brauers eine wichtige Rolle bei unserer Beurteilung des Getränks. Die Forschungsergebnisse der Stanford-Forscherinnen Shelley J. Correll, Sarah A. Soule und Elise Tak legen nahe, dass Geschlechterstereotype unsere Produktbewertung maßgeblich beeinflussen. Und in traditionell männlich geprägten Märkten – unter anderem auch bei Bier – können von Frauen hergestellte Produkte deutlich schlechter abschneiden. Aber: Bier-Snobs seien unabhängig vom Geschlecht des Brauers. Personen mit einem gewissen Maß an Fachwissen über ein Produkt achten eher auf dessen Eigenschaften und es ist ihnen egal, ob es von Männern oder Frauen hergestellt wird, so die Untersuchung weiter.
Unter Frauen, die ich kenne, ist die Befürchtung, Bier könne eine mögliche Gewichtszunahme verursachen, verbreiteter als unter Männern. Das ist zwar anekdotische Evidenz, darin steckt aber ein wenig Wahrheit. Immerhin hat ein Liter Pils etwa 420 Kalorien. Bier gilt in der allgemeinen Wahrnehmung als gehaltvoll. Deshalb warb das 2011 in den USA eingeführte „Chick Beer“ damit, nur 97 Kalorien pro Flasche zu beinhalten. „Flüssiges Brot“ ist eine gängige Bezeichnung für Bier, die auf die historischen Gemeinsamkeiten von Bier und Brot als Nahrungsmittel zurückgeht. Beide werden aus Getreide hergestellt und waren in der Vergangenheit wichtige Bestandteile der menschlichen Ernährung. „Drei Bier sind auch eine Mahlzeit, aber dann hast du noch nichts gegessen“, so eine platte Bauernweisheit.
Der berüchtigte Bierbauch dürfte bei Frauen gesellschaftlich unakzeptierter sein. Was bei Männern toleriert wird, gilt bei Frauen als deutlich unschöner. Denn einen Bauch, der auf den Konsum eines alkoholischen Getränks zurückzuführen ist – das möchte nun wirklich niemand. Hier greifen wieder traditionelle Körperbilder, der Wunsch von Frauen nach einem schlanken Körper ist nach wie vor ausgeprägter als bei Männern. In der Mainstream-Comic-Kultur tummeln sich bierbäuchtige Kerle. Barney Gumble aus der Serie Simpsons. Gibt es eine derartige Frauenfigur? Mir fällt keine ein.
Die Räumlichkeiten, in denen Bier kredenzt wird, wie Kneipen und Sportbars, sind traditionell auf Männer ausgerichtet, was das Stereotyp, Bier sei ein „Männergetränk“, weiter verstärkt. Oft korreliert dies mit der Übertragung von Sportereignissen wie Fußballspielen. Berliner Eckneipen, Metzer Eck, Zum Hecht, Schnelle Quelle, Willy Bresch, werden klassischerweise stärker von Männern frequentiert, bis heute – Orte, in denen vor allem Bier ausgeschenkt wird. Das Ambiente ist rustikal. Zum Herrengedeck gibt es dort kein weibliches Pendant. Dadurch entsteht eine Atmosphäre, die traditionell eher für Männer als für Frauen attraktiv ist. Solche Stereotype sind sozial konstruiert, wir können sie reflektieren und verändern.
Eine Situation, die ich oft erlebt habe: Ich sitze mit einem männlichen Freund in einer Bar, er hat ein Glas Grauburgunder bestellt, ich eine helle Halbe. In 80 Prozent der Fälle stellt der oder die Kellnerin das große Bierglas bei meiner männlichen Begleitung ab, in sehr wenigen Fällen bei mir.
Aber: Bier ist ein Thema für Feministinnen oder sollte es zumindest sein. Bier ist zu wichtig, um es den Männern zu überlassen. Genauso wenig wie das Biertrinken Männersache ist, war es historisch betrachtet das Bierbrauen. Archäologische Funde aus Mesopotamien zeigen, dass bereits vor über 5.000 Jahren Frauen Bier brauten – nicht nur für den Hausgebrauch, sondern auch für den Handel. In einer der ersten Hochkulturen der Menschheit, Sumer, war Ninkasi, die Göttin des Bieres, eine zentrale Figur. Sie hatte sogar ein eigenes „Bierlied“: ein Rezept in Versform, das den Brauprozess beschrieb.
Auch im alten Ägypten waren es Frauen, die das tägliche Bier herstellten. Bier war Grundnahrungsmittel, flüssiges Brot, und kein festliches Gelage kam ohne es aus. Die Griechen übernahmen den Gerstentrunk, die Römer sahen ihn lange als „barbarisch“ – tranken aber trotzdem, besonders in den Provinzen nördlich der Alpen.
Mit dem Mittelalter kam das Klosterbier. Benediktiner, Zisterzienser, Augustiner – die Mönche verfeinerten das Brauen, führten den Hopfen ein, der das Bier haltbarer machte. Doch auch hier gilt: Parallel dazu brauten weiterhin unzählige Bäuerinnen und Wirtinnen, oft nach regionalen Rezepten. In manchen Gegenden wurden diese „Alewives“ später von der Zunft ausgeschlossen – ein frühes Beispiel, wie ökonomische Monopole weibliche Arbeit verdrängen. Im Mittelalter ernährten sich alle von Biersuppen, Männer, Frauen, Kinder. Auch Martin Luthers Ehefrau Katharina von Bora lernte als Nonne das Bierbrauen.
Erst mit der Industrialisierung und Verwissenschaftlichung des Brauwesens wurde das Bier zur Männerdomäne. Männliches Expertentum in der arbeitsteiligen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft drängte die Frauen aus dem Feld.
Das ändert sich langsam, aber gewaltig: Seit kurzem drängen immer mehr Frauen in die Studiengänge für Brauereiwesen, immer öfter sind es die Töchter, die familiengeführte Brauereien übernehmen und in einer Kombination aus handwerklicher Tradition und zeitgemäßem Marketing geschickt modernisieren (Beispiel: Brlo). Sorgen machen müssen einem (oder besser: einer) die Tendenzen auf dem Biermarkt, der mehr noch als andere Märkte von Monopolisierung und Oligopol-Bildung geprägt ist und zur globalen Monokultur zu werden droht. Die beiden Big Player Anheuser-Busch InBev und Heineken vereinen anteilig fast die Hälfte des Weltmarktes auf sich und schlucken kleine Brauereien wie beim Bingedrinking-Wettsaufen.
Meine dionysische Leidenschaft für Bier, die Lust am Rausch, verstellt mir natürlich nicht die apollinische Sichtweise auf die mit Alkoholgenuss verbundenen Krankheiten. Dass ich hier schon wieder die männlichen Götter Dionysos und Apollon behühen muss, nervt trotzdem, schließlich gibt es ja auch dem Rausch zugetane Göttinen wie Aphrodite oder die Halbgöttin Methe oder Nymphen, Satyrinnen oder Bacchantinnen. Und genauso gibt es der Vernunft zugetane Göttinen wie Athene oder Themis. Letzteren folge ich, wenn ich meine Leidenschaft für Bier mit moderatem Konsum zelebriere, zumindest meistens. Kein Zweifel, dass die Konsultation medizinischer Empfehlungen vor dem Griff zum Glas oder zur Flasche sinnvoll sind: Für Männer wird etwa ein halber Liter Bier (mit einem Alkoholgehalt von zirka fünf Prozent) pro Tag und für Frauen 0,3 Liter Bier pro Tag als verträglich beurteilt – aber bitte zwei alkoholfreie Tage in der Woche einhalten!
Gerade bei Frauen ist der Alkoholkonsum in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Das bereitet der Medizin Sorge, denn Frauenkörper können Alkohol prinzipiell langsamer abbauen und werden durch dieselbe Menge Alkohol stärker geschädigt als Männer.
Weil der weibliche Alkoholkonsum rapide gestiegen ist, erschienen auch mehr Bücher von Autorinnen in den letzten Jahren, die die Folgen von übermäßigem Alkoholkonsum problematisieren. Sie treffen auf eine überwiegend von Männern geschriebene neue Abstinenzliteratur. Die Stigmatisierung von Frauen mit derartigen „devianten“ Verhaltensweisen hat in den letzten 20 Jahren stark abgenommen. Zu den Geschlechtsstereotypen zählt aber nach wie vor, dass ein häufigerer und stärkerer Alkoholkonsum eher bei Männern als bei Frauen toleriert wird.
Ein Beispiel für Bekenntnisliteratur zu weiblichem Alkoholismus ist Die Klarheit von Leslie Jamison. Die Amerikanerin schreibt darin: „Als ich im Herbst wieder in die Staaten zurückging, um in Yale ein Promotionsstudium zu beginnen, beschloss ich, ab jetzt anders zu trinken: kein Bier mehr, keinen Rum mehr. Nur noch klaren Alkohol, was mir bei der Vorstellung, wie er durch mich hindurchfloss, reiner vorkam.“ Bier mag sie also nicht: „Eines Abends bestellten die anderen Mädchen aus der Bäckerei nach der Arbeit in einem Pub namens The Sanctuary Bier – das Sanctuary war bekannt für sein Bier –, also bestellte ich auch ein Bier und nichts Stärkeres. Aber ich studierte auf der Karte sorgfältig die Angaben zu jedem Bier und orderte dann das hochprozentigste. ich nehme immer das mit dem ironischsten Namen, sagte ich, um zu erklären, warum ich Delirium Tremens bestellt hatte, und setzte hinzu: Ich hasse Bier. Woraufhin ich drei weitere bestellte.“ In Deutschland erschien 2016 von Elisabeth Raether Die Trinkende Frau. Sie schreibt darin: „Ich bedaure, dass die Gier nach Lammrippchen und der Wille zum Bier noch nicht so anerkannt sind.“
In der Kunst wird die biertrinkende Frau ambivalent dargestellt. Ein Gemälde von Edouard Manet von 1878 trägt den TItel „Bier trinkende Frauen“. Manet war der wichtigste Chronist des gesellschaftlichen Lebens im Paris des ausgehenden 19. Jahrhunderts, bekannt für seine detailgetreuen Ansichten aus Restaurants, Bars und bisweilen halbseidenen Etablissements. Es war das gemalte Tagebuch eines Flaneurs. Die Frauen auf seinem Gemälde tragen schwarze Hüte und zeittypisch hochgeschlossene Kleider. Eine führt ein Glas zum Mund. Beide befinden sich in einer intimen Situation. Ob sie auf Gesellschaft warten, sich entspannen, bleibt unklar. Eine Konversation zwischen beiden scheint nicht stattzufinden. Als „Die Biertrinkerinnen“ im April 1880 in Manets Einzelausstellung in den Räumen von La Vie Moderne gezeigt wurde, wetterte der Karikaturist Bertall gegen „solch schreckliche und vulgäre Typen … diese Serie biertrinkender Frauen“.
Beim Alkoholkonsum geht es nicht nur um Flüssigkeitsaufnahme und den Wunsch, sich selbst in einen Rauschzustand zu bringen. Alkohol ist mit dem Wunsch nach der Repräsentation eines bestimmten Lebensstils verbunden. Ich trinke Champagner, also bin ich elegant. Eine Flasche Champagner ist selbst bei Aldi teurer als ein teurer Weißwein im Feinkostladen. Bei Mädchen und Frauen spielt der Alkoholkonsum bei der Inszenierung ihrer Weiblichkeit eine komplexere Rolle, so eine Studie des Instituts für Suchtforschung.
Auch deshalb bleibe ich dabei: Ich liebe Bier, weil es sich nicht verstellt. Wein kann prätentiös sein, Whiskey distanziert, Cocktails manieriert – Bier bleibt direkt. Ich liebe die Vielfalt: vom bodenständigen Pils im Bahnhofskiosk bis zum komplexen Trappistenbier. Ich liebe, dass Bier gleichermaßen im Stadion, im Sternerestaurant und beim Grillabend funktioniert.
Vielleicht werden wir in ein paar Jahren zurückblicken und uns wundern, dass Bier je als Männersache galt. Lasst uns jede Frau mit einem Bier in der Hand als etwas ganz Normales akzeptieren. Thematisiert es nicht, sondern nehmt das als Standard hin. Nur in der stetigen Wiederholung einer affirmativen Position zu biertrinkenden Frauen wird den Männern die Deutungshoheit über ihr Lieblingsgetränk genommen.
Ich sitze wieder bei einem Dinner. Vor mir steht ein Glas Bier auf dem weiß gedeckten Tisch – golden, kühl, unprätentiös. Jemand sagt: „Ach, Sie trinken Bier?“ Ich nicke. „Natürlich.“ Und während der Schaum nach einem Schluck langsam im Glas hinabsickert, denke ich: Mögen Hopfen und Malz nicht verloren sein – schon gar nicht an Geschlechterklischees.