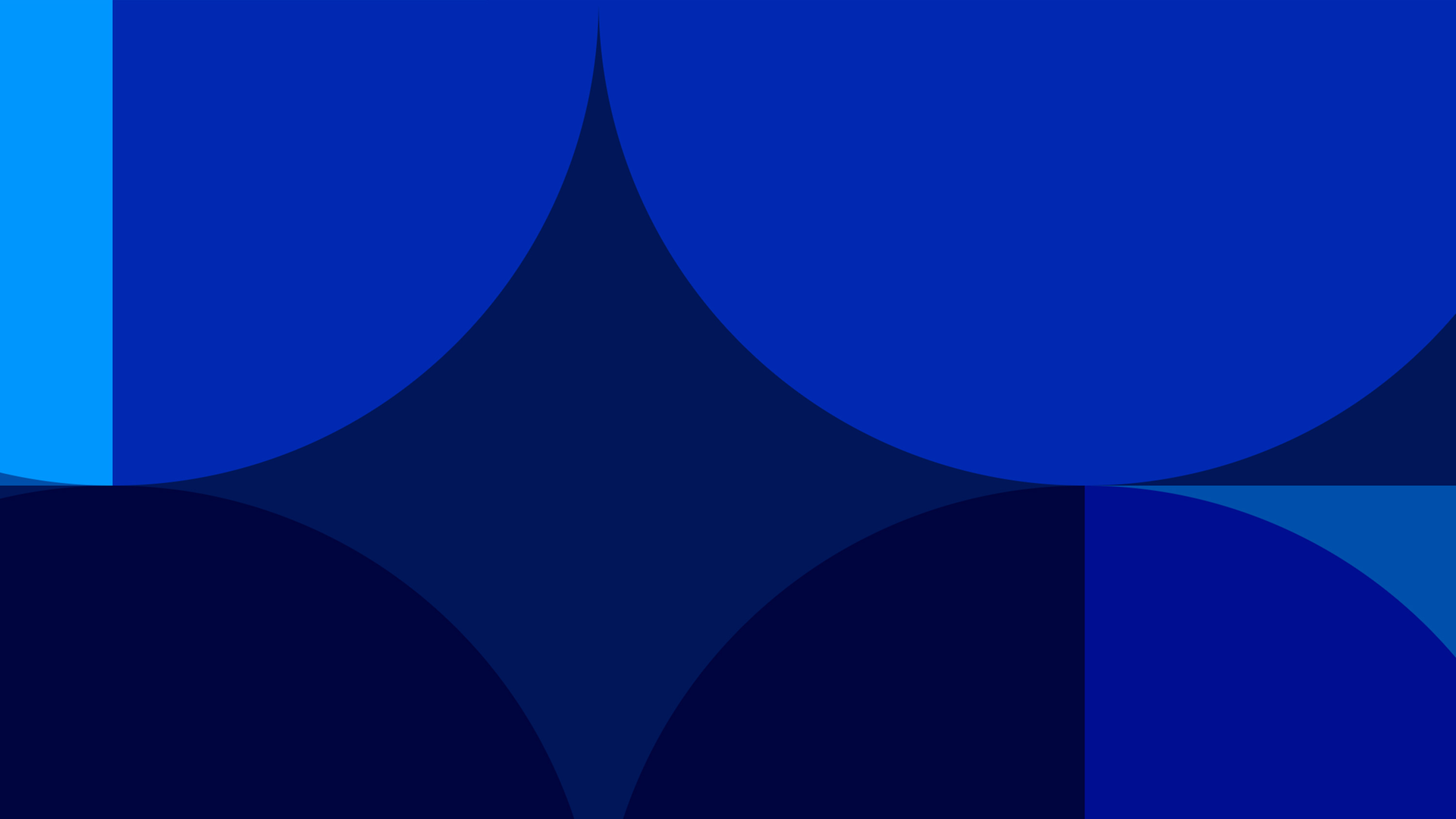Die Menschen stehen vor großen Herausforderungen: Klimawandel, Digitalisierung, Migration, Kriege und Konflikte. Epochale Brüche gehen Hand in Hand mit Umwälzungen der Bildungsinstitutionen. Wie sieht ein Curriculum, wie sehen Institutionen aus, die Bürger der Erde in diesem Jahrhundert brauchen? Der amerikanische Pädagoge Neil Postman (1931-2003) prangerte "technologische Verdummung" an und schlug drei neue grundlegende Schulfächer vor: Astronomie, Anthropologie und Archäologie. Wer sind wir im Weltall, was können wir und wozu sind wir fähig; was sagt uns unser historisches Erbe über die Zukunft? Das scheint ein schöner Gedanke zu sein. Aber wie sähe eine Schule aus, die diese Idee ernst nimmt?
Diese Sendung wurde erstmals am 10. Dezember 2023 ausgestrahlt.
Mathias Greffrath, Jahrgang 1945, ist Soziologe und Journalist. Er lebt in Berlin, arbeitet unter anderem für die "taz", die "ZEIT" und den Rundfunk. In den letzten Jahren hat er sich in Essays, Hörspielen und Kommentaren mit den sozialen und kulturellen Auswirkungen von Globalisierung und Klimawandel beschäftigt.
O-Ton Willy Brandt: „Die Schule der Nation ist die Schule.“
Willy Brandt, Kanzler einer sozialliberalen Koalition, sprach diesen Satz in der Regierungserklärung von 1969. Vor mehr als einem halben Jahrhundert.
Einige Jahre zuvor hatte der liberale Pädagoge Georg Picht die „Bildungskatastrophe“ ausgerufen. Deutschlands Universitäten und Schulen bildeten nicht mehr genug Akademiker, Ingenieure und Fachkräfte aus, das exportabhängige Land drohte im internationalen Wettbewerb zurückzufallen. Und darüber hinaus: Vorausschauende Modernisierung tat not:
O-Ton Brandt: „Die Bundesregierung beabsichtigt, verstärkt Haushaltsmittel für die Förderung der Informatik und der Entwicklung von Computer-Sprachen einzusetzen. Diese Seite der Datenverarbeitung ist besonders umfangreich und erfordert mehr Mittel als die Entwicklung der eigentlichen Rechenmaschinen. Man übertreibt nicht, wenn man der Computertechnik eine katalytische Wirkung nicht allein für die gesamte wissenschaftlich-technische Entwicklung zuspricht, sondern weit darüber hinaus auch für die industrielle Produktion, die Verwaltung und andere Bereiche.“
A tempo sollten jetzt Fakultäten für Informatik gegründet werden – so wie heute wieder. Und noch eine Zukunftsbaustelle wurde in jener Zeit von Willy Brandt eröffnet; genauer gesagt: schon einmal eröffnet, 1972 vor Nobelpreisträgern in Lindau:
O-Ton Brandt: „Die Auswirkungen von Umweltschädigungen erscheinen (...) nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich verschoben, so dass eine erhebliche Zeitspanne zwischen der Verursachung und der schädlichen Wirkung liegen kann. Die Gefahren werden häufig erst erkannt, wenn sie sich bereits millionenfach vervielfältigt haben. (…)
Man sollte daraus die Lehre ziehen, dass es insgesamt schon viel später ist, als wir denken möchten. Maßnahmen, die wir heute ergreifen, werden unheilvolle Prozesse unter Umständen erst in Jahren unter Kontrolle bringen können.
Es geht, meine Damen und Herren, um nicht weniger als darum, den Zusammenbruch unseres ökologischen Systems zu verhindern.“
Aber Modernisierung tat nicht nur Not in Bezug auf den Computerrückstand und die ökologischen Gefahren. Auch die Gesellschaft sollte moderner werden: Das deutsche Schulsystem war immer noch gegliedert wie nach der ersten industriellen Revolution: Volksschule für die arbeitenden Massen, Mittelschule für die kaufmännischen und technischen Kader, Abitur für die Führungskräfte.
1960 lag die Abiturientenquote insgesamt bei fünf Prozent, von denen wiederum nur sechs Prozent Arbeiterkinder waren. Der liberale Professor und FDP-Politiker Ralf Dahrendorf sah in dieser Ungleichverteilung von Bildung eine Gefahr für die Demokratie; er formulierte das „Bürgerrecht auf Bildung“. Bildungspolitik habe Sorge zu tragen, dass die Schüler und Schülerinnen aus sozial benachteiligten Familien die individuelle Unterstützung bekämen, die ihnen das Elternhaus nicht geben könne. Eine demokratische Schule solle, so Dahrendorf, solle den Menschen „Horizonte eröffnen, die niemand anders ihnen sichtbar macht. Sie darf sich um Menschen in der ganzen Weite ihrer Existenz kümmern. Sie darf erziehen.“
Mit der sozialliberalen Koalition von 1969 begann eine Phase von Hochschulgründungen und Schulreformen. Und von Auseinandersetzungen über das Schulsystem. Die ersten Gesamtschulen wurden eingerichtet und wurden sofort heißbekämpft von Eltern aus den begüterten und gebildeten Schichten, die um das Niveau des Abiturs und die Zukunft ihrer Kinder besorgt waren. Die Schule soll „erziehen“? War das nicht gegen das Elternrecht?
Aber aufs Ganze gesehen beförderte das kulturelle Klima der Zeit Veränderungen. Die sozialliberalen Reformer stützten sich auf Vorgänger, die schon in der Weimarer Republik Gemeinschaftsschulen gegründet hatten, mit einer Verbindung von praktischem, theoretischem und sozialem Wissen. Schulen, die der Entwicklung des „ganzen Menschen“ in gemeinschaftlichen Zusammenhängen den Vorrang gaben vor klassenmäßig aufgegliederten Lernmaschinen.
Neu ist in der Pädagogik wenig. Es wird nur vieles immer wieder vergessen. Und außerdem: Das Einfache ist schwer zu machen. Und oft genug macht der Fortschritt drei Schritte nach vorn und zwei zurück.
Auch dieser Modernisierungsschub im Bildungswesen währte nur ein Jahrzehnt. Dann stagnierte er. Der pädagogische Frühling mit seiner intellektuellen Unruhe, seinen Aufbrüchen, seinen Generationswechseln war in die Endzeit der Goldenen Dreißiger Jahre gefallen, jener Aufbaukonjunktur nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihren außerordentlich hohen Wachstumsraten, Wirtschaftswunder genannt.
Aber seit den Siebziger Jahren schrumpfte das Wachstum in den entwickelten kapitalistischen Industrienationen. Auf der Dringlichkeitsliste der Regierungen standen nun nicht länger Demokratisierung, Humanisierung der Arbeit und Umweltschutz, sondern die Sicherung der Wachstumsbedingungen. Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt first – Infrastruktur, Sozial- und Bildungspolitik second.
Aber das Ganze wurde zunehmend zu einem Wachstum auf Pump. Seit der Finanzkrise von 2008 wissen wir nicht nur, sondern spüren wir die wachsenden Risiken und Ungleichheiten; und mit jedem Sommer wächst das Wissen, dass der Wachstumspfad die Lebensgrundlagen aller Gesellschaften auf dem Globus gefährdet.
O-Ton Brandt: „Wir werden unseren Scharfsinn in steigendem Maße darauf verwenden müssen, wie wir von einer bloßen Wachstumsmaximierung zu einer ausgewogenen Wachstumsoptimierung gelangen können. Oder, mit anderen Worten, zu besseren Lebensbedingungen.“
Seit Willy Brandts programmatischem Satz von 1972 hat sich der Rahmen, in dem Kinder und Jugendliche ihre Musikvorlieben, ihre Kleidungssitten und ihre Identität ausbilden, bis an die Grenzen unserer Erde erweitert.
Stärker als je zuvor formt das ökonomische und politische Weltgeschehen das alltägliche Leben – bei Volkswagen in Wolfsburg sind chinesische Elektroautos Mittagsgespräch; die vor Hunger, Krieg, Klima oder Verfolgung flüchtenden Menschenmassen vergiften den Frieden in Gemeinden; die Debatten über klimaverträglichen Konsum spalten Familien. Mittelschichtler fürchten sich vorm Abstieg und dämpfen lieber ihre moralische Sensibilität und ihre politischen Gefühle als ihr Konsumniveau.
Das ist die Situation, in der wieder einmal die Bildungskatastrophe beschworen wird. Seit Jahren. Seit Jahren ohne Folgen. Schon vor dem Corona-Schock erfüllte mehr als ein Fünftel der 15jährigen nicht die Mindeststandards in Rechnen oder Lesen oder Schreiben, und seither, so zeigt es die aktuellste Untersuchung, seither hat sich sie Lage noch verschlimmert. Es fehlen selbst nach konservativen Schätzungen 23.500 Lehrkräfte; für den ab 2025 gesetzlich garantierten Anspruch auf Ganztagsschulen ca. 50.000 Betreuer; in den Kitas fehlen bis 2025, je nach Schätzung 20- bis 75.000 Fachkräfte. Bei 40 Prozent der Kinder sind die Eltern keine deutschen Muttersprachler und 40 Prozent der Lehrer arbeiten nur Teilzeit. In der Konsequenz wandert in eine Privatschule aus, wer es sich leisten kann, in diesem Jahr sind es 9,2 Prozent aller Schüler, 50 Prozent mehr als vor 20 Jahren. Und jeder Exodus aus dem öffentlichen Schulsystem beschleunigt die Spiralen nach unten.
Bildungsstiftungen und Journalisten rufen regelmäßig den Notstand aus. Man muss die Krisen nutzen, rufen die Kommentatoren und zitieren den britischen Weltkriegskanzler Winston Churchill, Krisen sind eine Chance für große Veränderungen. Aber Corona und der Zusammenbruch des Schulalltags haben mitnichten zu einer Radikalisierung des Unmuts in der Lehrerschaft und bei den Eltern geführt. Dafür nehmen jetzt andere die Chancen wahr.
„Digitale Bildung für alle“ soll für die „Schule von Morgen“ sorgen. Mittelständische Produzenten digitaler Bildungswerkzeuge geben sich den Anstrich einer Volksbewegung, Vordenker der CDU wollen den „allseits bekannten und beklagten Lehrermangel“ mit verstärktem Computereinsatz lindern. Digitalisierter Unterricht sei keine Notlösung, Liberalkonservative feiern ihn als ein Werkzeug der Chancengleichheit, als „Humboldt für alle“.
Das ist natürlich Humbug. Nach allen Erkenntnissen ist der Vorsprung der Kinder aus leistungsaffinen Familien, in denen Aufstiegsmotivationen getriggert werden, kaum einzuholen. Nach wie vor legt das Elternhaus den Grund für Bildungskarrieren. Und nach wie vor gilt die Studie aller Studien, die Untersuchung des neuseeländischen Pädagogen John Hattie, die bestätigt, was jeder weiß, der zur Schule gegangen ist: Die entscheidende Größe für das Lernen ist der einzelne Lehrer. Aber immer weiter fließen die neuen Investitionen eher in Silizium als in Studiengänge, in Verkabelung statt in kleine Klassen, in Monitore statt in Menschen. Und wenn heute von Medienerziehung geredet wird, wenn es sie überhaupt gibt, beschränkt sie sich meist auf Nutzungswissen, Bedienungsprobleme, Virenschutz. Allenfalls noch geht es um Datenschutz und die Gefahr von Überwachung. Was aber not täte, schreibt der Medienphilosoph Roberto Simanowski, …
„…wäre nicht nur ein Informationsupdate, sondern zugleich ein Perspektivenwechsel: vom Nutzungs- und Verfügungswissen zur Reflexion der gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung.“
Denn Algorithmen sind nicht unschuldig. Sie gestalten soziale Verhältnisse, denn sie sind eingebettet in ökonomische Strukturen und in Machtkalküle. Die durch avancierte Datenanalyse mögliche Feinkalkulation von Risiken untergräbt das Solidarprinzip im Versicherungswesen. Die Automatisierung ergreift nun auch komplexe und erfahrungsbedürftige Tätigkeiten, das steigert die Produktivität, aber untergräbt zugleich auch die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer. Die Plattformökonomie untergräbt die Selbständigkeit des Mittelstands in Handel, Produktion und Dienstleistungen, die Codierungen der sogenannten Sozialen Medien prämieren das Schrille, das Aggressive und zersetzen die öffentliche Sphäre.
Lehrer, die solche Zusammenhänge reflektieren können, müssten viel über Algorithmen, Plattformökonomie, Troll-Techniken wissen; vor allem aber müssten sie ein wirklich umfassendes Weltwissen haben. Fake-News zu erkennen und die Obszönität von Trolls zu demonstrieren, das mag noch leicht sein; aber Pädagogen, Lehrer, Mentoren müssten auch noch in der Lage sein, ad hoc in die Vorstellungswelt ihrer Schüler zu steigen und zu vermitteln, „dass es anders ist“. Das Urteilsvermögen und die Kritikfähigkeit von Heranwachsenden zu schulen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Und sie macht den Lehrer angreifbar. Denn worum geht es bei Fake News und Fälschungen, bei Hate Speech, Trollen und ästhetischer oder lumpencharismatischer Einflussnahme? Letztlich um Sachverhalte, die gesellschaftlich umstritten sind.
Es ist ein Paradox: Je demokratischer die Gesellschaft wurde, desto stärker ist seit dem 19. Jahrhundert das Schulwesen zum Ort parteipolitischer Streitigkeiten geworden. Die schulpolitischen Ziele der Parteien orientierten sich schon immer und so auch heute an ihren gesellschaftspolitischen Leitbildern. So war und so ist die Schulpolitik eine Funktion der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Bürgerliche Eltern kämpfen gegen die Gesamtschule, Klimaskeptiker gegen Physiklehrer, Antirassisten gegen Literaturkanons, Säkularisten gegen Gebetsräume, Konservative gegen den Vorschulzwang.
Aber alle diese weltanschaulichen und kulturellen Auseinandersetzungen wirken heute rudimentär angesichts der beiden großen Probleme: Die Grundschulausbildung sichert in dieser lange vernachlässigten Einwanderungsgesellschaft nicht länger die einfachsten Qualifikationen in ausreichender Zahl. Und das zweite: Die Schule kann ihre Aufgabe, für gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sorgen, immer weniger erfüllen. Die Integration unterschiedlicher Milieus, Wohlstandsniveaus, kultureller Kreise war solange kein dramatisches Problem wie diese Gesellschaft ihre Probleme und Ungleichheiten durch Wachstum lösen konnte. Auch in den Jahrzehnten des stagnierenden Wachstums überlebte noch die Gewissheit, dass es, wenn auch in unterschiedlichen Tempi und unterschiedlichen Quantitäten, immer mehr geben wird, wenn auch für die einen viel mehr und für die vielen nicht ganz so viel mehr. Aber nun bröckelt dieser Wachstumskitt, der das Land gut und friedlich zusammengehalten hat. Und, wir erleben es gerade, Geld für große Investitionen erhält allenfalls, wer Wachstum verspricht und ein erneutes Anspringen der Konjunktur.
Die Zeichen stehen darauf, dass wir keine Konjunkturdelle zu überwinden haben, sondern direkt an einer Epochenschwelle stehen. Ich halte es sogar nicht für übertrieben, die Zeit, in der wir leben, die Zweite Kopernikanische Revolution zu nennen. Denn wie vor 500 Jahren geht es um ein verändertes Bild von Erde und Kosmos.
Was wir die Neuzeit nennen, war eine Ausweitung der Horizonte und der menschlichen Macht: Eroberung neuer Territorien, Entwicklung immer neuer Bedürfnisse, Hinausschieben aller Grenzen, der inneren und der äußeren, Beschleunigung, Fortschritt, Landnahme. Die Klimadaten, der Artenschwund, das sinkende Grundwasser, die steigende Vermüllung der Meere, das alles mutet der Menschheit nun eine Gegenbewegung zu: Nicht Fortschritt, sondern Anpassung an die biologische Nische mit einer technischen Revolution, aber auch mit der Rücknahme der materiellen Ansprüche an Raum- und Ressourcennutzung, mit Einsammeln der hypertrophen Ansprüche des weißen Nordens, die nicht verallgemeinerbar sind. Bremsen, Verlangsamen, Entschleunigen, Rückzug. Aber wie es um unsere Bereitschaft steht, um der Zukunft willen, auf das zu verzichten was wir haben, das kann man daran ablesen, dass Politiker und Ökonomen dieses Wort – Verzicht – meiden, wie der Teufel, als es ihn noch gab, das Weihwasser.
Und wie sieht eine Schule aus, die auf diese Situation reagiert?
Die Digitalisierung, der Klimawandel, die Migration – sie zwingen uns gleichermaßen, unser Urteilsvermögen zu schärfen, unsere Weltoffenheit zu steigern, unsere Lebensart zu überprüfen. Nicht nur mehr zu wissen, neues zu denken, sondern anders zu leben, neue Verhaltensweisen, neue Fähigkeiten zu entwickeln. Und das heißt: Üben. Und dafür gibt es, wenn es ein Programm für die ganze Gesellschaft sein soll, nur einen denkbaren Ort: die Schule. Und einen Ort, an dem, so wie er jetzt funktioniert, diese Aufgabe kaum zu lösen ist: die Schule.
Aber wie gesagt: Es gibt wenig Neues in der Pädagogik. Es wird nur immer wieder vergessen. Zehn Jahre vor dem Reformschub der Sechziger Jahre schrieb der eher konservative Soziologie Helmut Schelsky einen Aufsatz zum Thema „Schule und Erziehung in der industriellen Gesellschaft“.
Der Inhalt, kurzgefasst: Die kognitiven und emotionalen Anforderungen des Berufslebens, der Trend zur Kleinfamilie, zu Alleinerziehenden, zur Frauenerwerbstätigkeit – das alles erfordere eine stärkere Übernahme der Erziehung durch die Schule, weit über die Vermittlung von Wissen hinaus. Auch die basalen Eigenschaften wie Ordnung, Pünktlichkeit, Leistungsbereitschaft einzuüben, würde nun zur Aufgabe der Schule. Damit werde der „dauerhafte und enge“ Elternkontakt der Lehrer zur zentralen Aufgabe, nicht als „obendrauf“, und zwar nicht durch Beiräte, sondern durch Familienbesuche, und nicht durch outgesourcte Sozialarbeit. Lehrer müssten mehr sein als Wissensvermittler: Mentoren, Erzieher, Vorbilder.
Schelsky, beileibe kein Linker, forderte damals eine Unterrichtung in den Familienfähigkeiten und „Freizeiterziehung“ als Reaktion auf die „Enthemmung des Konsumstrebens“, ja des „Konsumterrors“. Schule darf erziehen, so war das Wort von Dahrendorf. Schelsky entwarf das Bild einer Gemeinschaftsschule, die Technik und Tradition verbindet und sozialen Zusammenhalt herstellt. Schule müsse in die Mitte der Gesellschaft geholt, zum sozialen Ort werden. Das war 1957.
Der Gedanke war auch damals nicht neu, aber er scheint heute attraktiver denn je. Wo man die Schule in irgendwelche Mittelpunktschulzentren ausgelagert hat, da muss man sie zurückholen. Ins Leben der Stadtteile, der Dörfer, der Kieze.
Die Schule in einer Zeit der Umbrüche: Sie könnte auch die Fähigkeiten trainieren, die in einer schrumpfenden Wirtschaft schon jetzt immer weniger von einem gut gepufferten Sozialstaat übernommen werden können, und die eigentlich sowieso nicht kommerzialisiert gehören: Pflege der Alten, das nannte man früher Pietät; Verantwortung für den Zustand der Straßen, der der Nachbarschaft, der Stadt übernehmen, das nannte man früher Bürgersinn; Praktiken einüben und ausüben, die früher im Haushalt gelernt wurden und jetzt zu bezahlten Dienstleistungen geworden sind: medizinischen, gastronomischen, kulturellen. Keine Schule ohne eine Küche, in der die Kinder ihr Essen selber kochen; keine Schule ohne einen Acker oder wenigstens Garten, von dem sie die Rohstoffe dafür beziehen oder doch einen Teil davon, kein Curriculum ohne Medizinunterricht, theoretisch und praktisch. Schulen, die sich ganz konkret öffnen: für nächtliche Hallenfußballturniere und Kiezkonzerte, für arabische Hochzeiten, Computerkurse für Rentnerinnen, Schuldnerberatung, Reparaturworkshops. Solche „Schulgemeinden“ würden die Kenntnisse und das Engagement der Eltern, also der Handwerkerinnen, der Musiker, der Köchinnen, der Rechtsanwälte, der Programmiererinnen benutzen, damit die Nachwachsenden nicht nur in zwei Wochen Praktikum am Leben schnuppern, sondern von Beginn an aktiv teilnehmen können. Kleine Inseln der Öffentlichkeit, Bürgerschulen, direkt und analog könnten sie Bollwerke gegen die vordringenden Wellen des Weltverzehrs und der digitalen Zerstreuung sein.
So könnten sie Werkstätten einer Gesellschaft im Aufbruch sein.
Wie hieß es bei Dahrendorf?
Schule soll den Menschen „Horizonte eröffnen, die niemand anders ihnen sichtbar macht. Sie darf sich um Menschen in der ganzen Weite ihrer Existenz kümmern. Sie darf erziehen.“
Schöne Ideen, höre ich den Einwand. Klingen nach dem Besten aus den Zwanzigern und Sechzigern und Siebzigern, nach Gemeinschaftsschulbewegung der Weimarer Jahre, nach Ivan Illich und der Laborschule in Bielefeld.
Warum auch nicht?
Aber es gibt auch eine defensive, eine weniger idyllische Variante dieses Plädoyers für die Gemeindeschule. Aus England kommt dieser Tage die Meldung, dass der soziale Kontrakt zwischen Eltern und Schule zu zerbrechen droht. Dass nach Corona und der Phase des home schoolings der Schulbesuch in vielen gesellschaftlichen Milieus nicht mehr selbstverständlich und zwingend ist. Dass Kinder zu Hause bleiben, wie und wann es ihnen oder den Eltern passt, dass Influencer gegen Lehrer ausgespielt werden, Eltern auf Hinweise der Lehrer aggressiv reagieren. Eine problematische Folge dabei sei, dass es in prekären Familien keine gesellschaftliche Instanz mehr gibt, um die herum die Tagesroutinen von Erwachsenen und Kindern organisiert sind. Prekär seien allerdings auch Mittelschichtsfamilien, die ihre Kurzreisen oder ihre Urlaubsplanung frei gestalten wollen und die Kinder mitnehmen. Wenn der Pakt von Lehrern und Eltern zerfalle, so die oberste Schulinspektorin des Landes, dann drohe eine weitere Lockerung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Es entstehen dann Lücken im sozialen Gewebe, in die hinein dann bestenfalls die telematische Bildungsindustrie einrücken kann. Ist das unsere Zukunft?
Noch ein Einwand: Viele dieser progressiven Bildungsideen klingen nach Dezentralisierung, Lokalismus und auch ein wenig nach Anarchie. Aber geht es ohne ein paar zentrale Vorgaben ab? Wäre das nicht der Weg in 1.000 statt in 16 Arten, das Abitur zu machen? Wie kommt man von der Experimentierschule zur Schule der Nation? Zur Einheit der Nation in einer Welt in Bewegung? Zum Einüben in Zusammenhalt? Zum Blick über den Tellerrand der Gemeinde hinein in die Welt?
Neil Postman, der große Soziologe der Kindheit, der Medien und der Erziehung, schlug in den Neunziger Jahren ein Kerncurriculum für das nächste Jahrhundert vor. Astronomie, Archäologie und Anthropologie sollten Hauptfächer werden. Das klang exotisch, nach neuen Nebenfächern, nach Orchideenfächern ohne unmittelbar praktischen Nutzen. Aber es steckt mehr hinter diesem Vorschlag. Er zielt auf eine, vielleicht auf die Hauptleistung der Schule, die ebenso wichtig wie das Erlernen elementarer Kulturtechniken.
Die Sozialisation, die Beheimatung in der Welt, in der wir leben auf diesem Planeten, in der Gemeinschaft, in der wir sie erleiden und verändern. Heute hieße das: Heimischwerdenkönnen in einer Welt, in der Migration und Kulturbrüche nationale Bildungstraditionen haben ausfransen lassen, in der es sicherlich geteilte Werte, aber keinen verbindlichen kulturellen Kanon mehr gibt. In der mich nicht die nationale Herkunft mit meinen Nächsten verbindet, wenn es gut geht aber die Sorge um die Zukunft und unsere gemeinsame Präsenz in der Zeitenwende.
Astronomie, Archäologie und Anthropologie könnten dabei helfen.
Astronomie: Denn wo wir herkommen, wie der lange Weg vom Urknall zum gefährdeten Unikat eines von denkenden Tieren besiedelten Planeten aussah, wie wir uns die Welt jenseits aller Galaxien vorstellen, was jenseits des Vorstellbaren ist, wie viele Welten es gibt, wie uns der Blick auf die Erde von außen verändert, das sind Fragen, die sich unabhängig von Rasse, Religion, Klasse und Abstammung stellen.
Anthropologie: Wozu das denkende, Werkzeug produzierende, fantasierende, glaubende und singende, aber nicht genetisch festgelegte, sondern unspezialisierte und weltoffene Tier fähig ist, wie zahlreich seine Wege, was allen gemeinsam ist, und warum sie doch so verschieden sind, wo es biologisch fixiert ist und wie groß der Spielraum seiner Anpassungsfähigkeit und Weltoffenheit ist.
Und Archäologie: Das Fach, das aus den Gegenständen vergangener Lebenswelten Zusammenhänge konstruieren, Mutmaßungen anstellen, Fantasien entwickeln kann. Auch über Gesellschaften, die untergegangen sind, durch Naturgewalten oder eigene Taten.
Alles das zu erörtern kann Stoff abgeben für eine Schule der Toleranz, der Kooperation, der Zuversicht. Einheit und Unterschied lieben lernen. Bodenhaftung in der Geschichte finden und Empathie mit der Welt. Die tastenden Antworten, die ein solcher Unterricht finden könnte – auch sie könnten motivieren zum Aufbruch in die zweite kopernikanische Wende. Den Menschen
„Horizonte eröffnen, die niemand anders sichtbar macht.“
Alle wissen, was zu tun ist, aber keiner tut es. Die Parallele zur Klimakatastrophe ist schlagend. Wenn wir jetzt nicht handeln, werden die Schüler von heute in zehn Jahren in einer wenig attraktiven Welt leben und ihre Chancen für ein selbstbestimmtes Leben in Sicherheit und Frieden stünden nicht gut. Die Einschränkung von Lebenschancen aber ist eine Einschränkung von Freiheit – so die Argumentation, mit der das Bundesverfassungsgericht vor zwei Jahren das unzulängliche Klimagesetz der Regierung kippte und das Recht auf „intertemporale Freiheitssicherung“ in die Runde warf.
Und kürzlich, in der Corona-Zeit, hat das Verfassungsgericht ein weiteres Recht proklamiert: auf den „unverzichtbaren Mindeststandard von Bildungsangeboten“, auf „gleichen Zugang zu Bildungschancen“, welche die „Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zu Persönlichkeiten ermöglichen, die ihre Fähigkeiten und Begabungen entfalten und selbstbestimmt an der Gesellschaft teilhaben können“.
Das ging ein wenig unter, aber es ist eine kräftige Aufforderung an Lehrer, Bildungsforscher und Bürger, mal zu definieren, was für humanistische Exportweltmeister „unverzichtbar“ sein soll.
Das kann dauern. Aber da mit jedem Jahr Bildungschancen zerstört werden: Wo bleibt die Klage einer aufgeweckten 13-jährigen Tochter der dritten Einwanderergeneration aus Essen-Altenessen oder des dreijährigen Sohnes eine alleinerziehende Mutter aus München-Milbertshofen: für eine Schule, die in Ausstattung, Standards und Lehrer-Schüler-Quote den besten Schulen des Landes nicht nachsteht? Wenn die parlamentarischen Prozesse im Parallelogramm der gelähmten Kräfte verharren – vielleicht hilft ja die Besinnung auf die Gewaltenteilung und das Verfassungsrecht.
Wegen der Bildungshoheit der Länder sollten auch gleich 16 solcher Klagen oder auch ein paar mehr in koordinierter Weise bei allen Landesverfassungsgerichten eingereicht werden.
Und wenn auch das nichts nützt?
„Wenn wir unser eigenes Reden vom Bildungsnotstand ernst nehmen, dann müssen wir über (…) unverbindliche öffentliche Appelle an die Politik hinauskommen.“
Das steht in dem flammenden Appell, den der ehemalige Bildungs‑Staatssekretär Mark Rackles in einer seiner unverdrossen wütenden Kolumnen formulierte:
„Ein ‚Notstand‘ ist ein juristischer Begriff und ein Rechtfertigungsgrund. Die Notstands- und Katastrophenrhetorik richtet sich dann nicht an die politischen Entscheidungsträger der Bildungsrepublik Deutschland. Sie richtet sich viel mehr an die Verantwortungsträger der Bildungspraxis, an die Menschen vor Ort in den Schulen und Bildungseinrichtungen. Wenn die Politik auf den Bildungsnotstand und den anhaltenden Protest der Zivilgesellschaft nicht reagiert, dann kann es Zeit für neue Formen des zivilen Ungehorsams sein. Wenn eine Schule ihrem grundgesetzlichen Auftrag nicht mehr nachkommen kann, dann kann sie zum wiederholten Male den Notstand beschreiben. Sie könnte aber auch ein Zeichen setzen und den Laden schließen. (…) Weniger Rhetorik, mehr Tat!“
Das klingt gut, aber: Können Sie sich vorstellen, dass deutsche Beamte streiken? Für die Zukunft der Schule; für eine zukunftsfähige Schule?