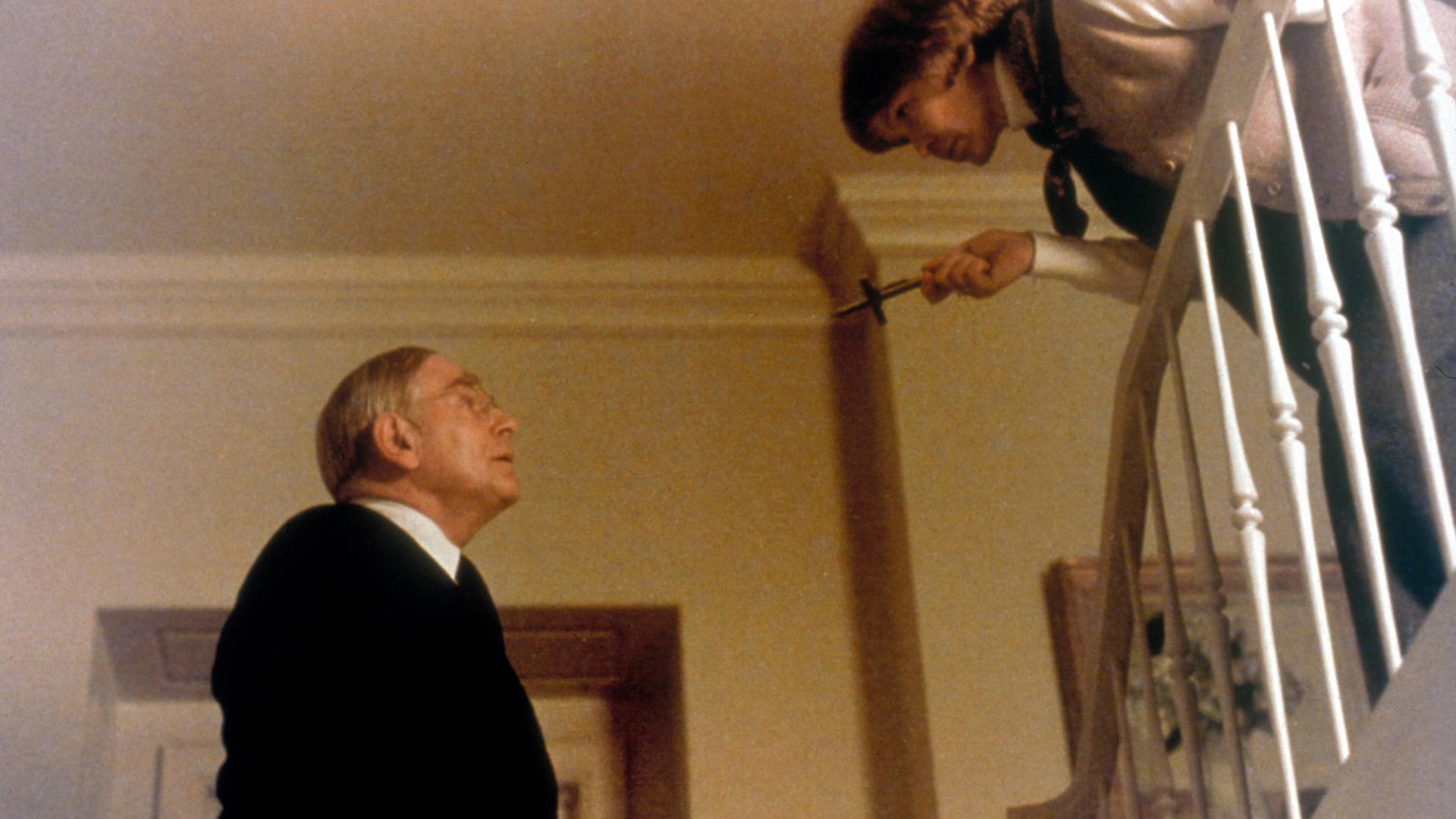In der Pandemie schlug die Stunde der Modellierer. Fachleute, die mit mathematischen Formeln Szenarien entwerfen, wie viele Menschen sich anstecken werden, im Krankenhaus landen oder sterben. Auch Andreas Deutsch gehört zu diesen Experten. Der Informatik-Professor an der TU Dresden wollte wissen, welchen Einfluss der sogenannte Lockdown auf das Pandemiegeschehen der ersten Welle hatten. Denn ihm war aufgefallen: In allen Staaten, in denen solche Maßnahmen verhängt worden waren, konnte das exponentielle Wachstum gebrochen werden – und das, obwohl sich die Kontaktbeschränkungen von Land zu Land deutlich unterschieden. Mit traditionellen epidemiologischen Modellen kam er hier nicht weiter, und dafür gibt es einen Grund.
„In diesen klassischen Modellen wird angenommen, dass die Bevölkerung zufällig gemischt ist. Das heißt, diese Modelle beschreiben eine Situation, in der jeder Mensch jeden Tag andere zufällig ausgewählte Personen trifft. Somit sind Kontaktheterogenitäten, also zum Beispiel unterschiedliche Kontaktzahlen von Menschen, nicht berücksichtigt.“
Mehr zum Thema Modellierer:
Algorithmen im Alltag - Wettervorhersagen
Kommentar: Pandemie-Modellrechnungen - Gefährliche Zahlenspiele
Algorithmen im Alltag - Wettervorhersagen
Kommentar: Pandemie-Modellrechnungen - Gefährliche Zahlenspiele
Tatsächlich sind in der Gesellschaft Kontakte zwischen Menschen ungleich verteilt, erklärt Andreas Deutsch. Manche Menschen sind in Vereinen aktiv und besitzen einen großen Freundeskreis, oder treffen berufsbedingt viele Personen, während andere eher wie ein Einsiedler leben. Theoretisch beschreiben lässt sich dieses komplexe Geflecht mit Hilfe von Kontaktnetzwerken.
„Und diese Netzwerke bestehen aus Knoten. Das sind die Menschen, die am Infektionsgeschehen teilnehmen, und den Verbindungen der Knoten. Und so eine Verbindung beziehungsweise ein Link steht für zwei Menschen, die sich anstecken können. Und vorstellen kann man sich ein solches Netzwerk als Spinnennetz, das hochdynamisch ist, da sich ja die Kontakte der Menschen zeitlich verändern.“
Die Kontakte sind im Netzwerk ungleichmäßig verteilt
Innerhalb der Netzwerke existieren typischerweise Anhäufungen von Knoten, die untereinander hochgradig verbunden sind, sogenannte Cluster. Das sind Menschen, die eine sogenannte Clique bilden. Eine Familie oder eine Bürogemeinschaft. Solche Netzwerke können dann auch Phänomene erklären, die sich mit den klassischen epidemiologischen Modellen nicht abbilden lassen.
„Ein bekanntes Beispiel sind sogenannte Superspreader. Das sind Personen, die im Mittel mehr Kontakt haben als andere. Und solche Phänomene, die von Superspreadern getrieben werden, die lassen sich von den klassischen Modellen nicht untersuchen.“
Um das Verhalten der Menschen in Deutschland kurz vor und einen gewissen Zeitraum nach der ersten Corona-Welle im Jahr 2020 zu untersuchen, hat Andreas Deutsch beide Ansätze miteinander kombiniert: Ein klassisches Epidemiemodell mit einem Kontaktnetzwerk. Daran konnte er zeigen: Die Lockdown-Maßnahmen wirkten, weil die Menschen ihre Kontakte deutlich reduzierten – auf einen kleinen, gleichbleibenden Kreis, einen Cluster. Daneben gab es allerdings auch zufällige Kontakte: Begegnungen in der Bahn, beim Einkaufen oder auch unvermeidbare Kontakte im Berufsleben, wenn jemand zum Beispiel viele verschiedene Kunden trifft.
„Vor dem Lockdown hatten die Menschen in Deutschland durchschnittlich 20 vorwiegend zufällige Kontakte. Nach dem Einsetzen des Lockdowns waren es dann zirka sechs, die stark geclustert waren, also in Cliquen. Und im Sommer hat sich das wieder verändert, also die Anzahl der zufälligen Kontakte ist gestiegen, hat aber nicht die Zahl 20 erreicht von vor dem Lockdown.“
Zufällige Kontakte als kritischer Treiber der Pandemie
Gerade den zufälligen Kontakten kommt eine kritische Bedeutung zu: Denn sie verbinden einzelne Cluster, einzelne Cliquen. Hier springt das Virus also von einer Gruppe zur anderen. Am Modell lässt sich zeigen: Reduziert man die Zahl dieser zufälligen Kontakte, lässt sich das exponentielle Wachstum brechen. Denn sie sind es, die das Pandemiegeschehen antreiben.
„Man muss nicht alle Kontakte unterbrechen, sondern eben Kontakte, die Verbindungen zwischen Gruppen herstellen können. Man kann durchaus im Haushalt oder in kleinen Gruppen miteinander interagieren. Man sollte nur eine gewisse Konstanz in diesen Gruppen über einen längeren Zeitraum möglichst anstreben.“
Und auch mit einem anderen Mythos räumt die Netzwerkanalyse auf: Dass die Corona-Wellen "von alleine“ gebrochen seien, dass also Einschränkungen überflüssig gewesen seien. Der Datenexperte Sten Rüdiger konnte zeigen, dass die Menschen in Deutschland einfach schon vor dem Beginn des offiziellen Lockdowns in der ersten Welle ihre Kontakte freiwillig reduziert hatten. Er arbeitet bei NetCheck, einem Dienstleister aus der Mobilfunkbranche. Ausgewertet hat er zeitaufgelöste GPS-Mobilfunkdaten. Die sammelt er mithilfe von Smartphone-Apps, anonymisiert und datenschutzkonform.
„Und dadurch bekommen wir eben auch die GPS-Informationen oder Stichproben der Lokalisierung. Und was wir dann halt tun, ist, dass wir immer zwei Mobilfunkgeräte oder die Wege von zwei Mobilfunkgeräten vergleichen und dann sehen eben, ob diese Geräte am gleichen Ort zur gleichen Zeit waren.“

In Mobilfunkdaten spiegelt sich die Infektionsdynamik
Daraus lassen sich Netzwerke rekonstruieren mit Tausenden von Knoten. Die GPS-Daten lassen eine sehr viel höhere Auflösung zu als ähnliche Mobilitätsstudien, die sich bloß auf die Funkzellen stützen, in denen die Geräte eingeloggt sind.
„Bei GPS sagt man so, eigentlich so um die fünf Meter. Funkzelleninformationen sind natürlich sehr viel ungenauer, im städtischen Bereich dann maximal fünfzig oder hundert Meter Auflösung.“
Und mit diesen Daten ist nicht nur ein Rückblick möglich auf das Verhalten in vergangenen Lockdowns. Sondern ein Bild der aktuellen Infektionsdynamik.
„Wir sehen auch eine starke Variabilität, also von Tag zu Tag, Also das heißt, jemand hat vielleicht unter der Woche nicht so viele Kontakte, aber dann am Wochenende auf einer Veranstaltung dann viele Kontakte.“
Der Kontaktindex als zeitnaher Indikator
Aus den Daten errechnet Sten Rüdiger einen statistischen Kennwert, den er als Kontaktindex bezeichnet. In ihm stecken Informationen zur mittleren Zahl der Kontakte, aber auch Superspreading-Ereignisse werden mit eingerechnet. Dadurch ergibt sich ein zeitnahes Bild, wohin sich die Pandemie in Deutschland bewegt, ein Prognosewerkzeug.
„Einer der Vorteile des Kontaktindex ist, dass wir damit quasi, dass wir die Infektionswelle damit quasi in Echtzeit verfolgen können. Weil wir den täglichen Wert des Kontaktindex mit einem Verzug von maximal drei Tagen ja schon kennen und den entsprechenden R-Wert, also die Reproduktionszahl dazu, meinetwegen jetzt offiziell vom Robert-Koch-Institut, das kennt man ja erst zwei bis drei Wochen später.“
Und noch etwas zeigte die Netzwerkanalyse: Von der freiwilligen sozialen Distanzierung während der ersten Welle war zu Beginn der sogenannten Bundesnotbremse im April des vergangenen Jahres wenig zu spüren. Die Zahl der Kontakte stieg damals sogar leicht an – offenbar ein Zeichen der Pandemiemüdigkeit.