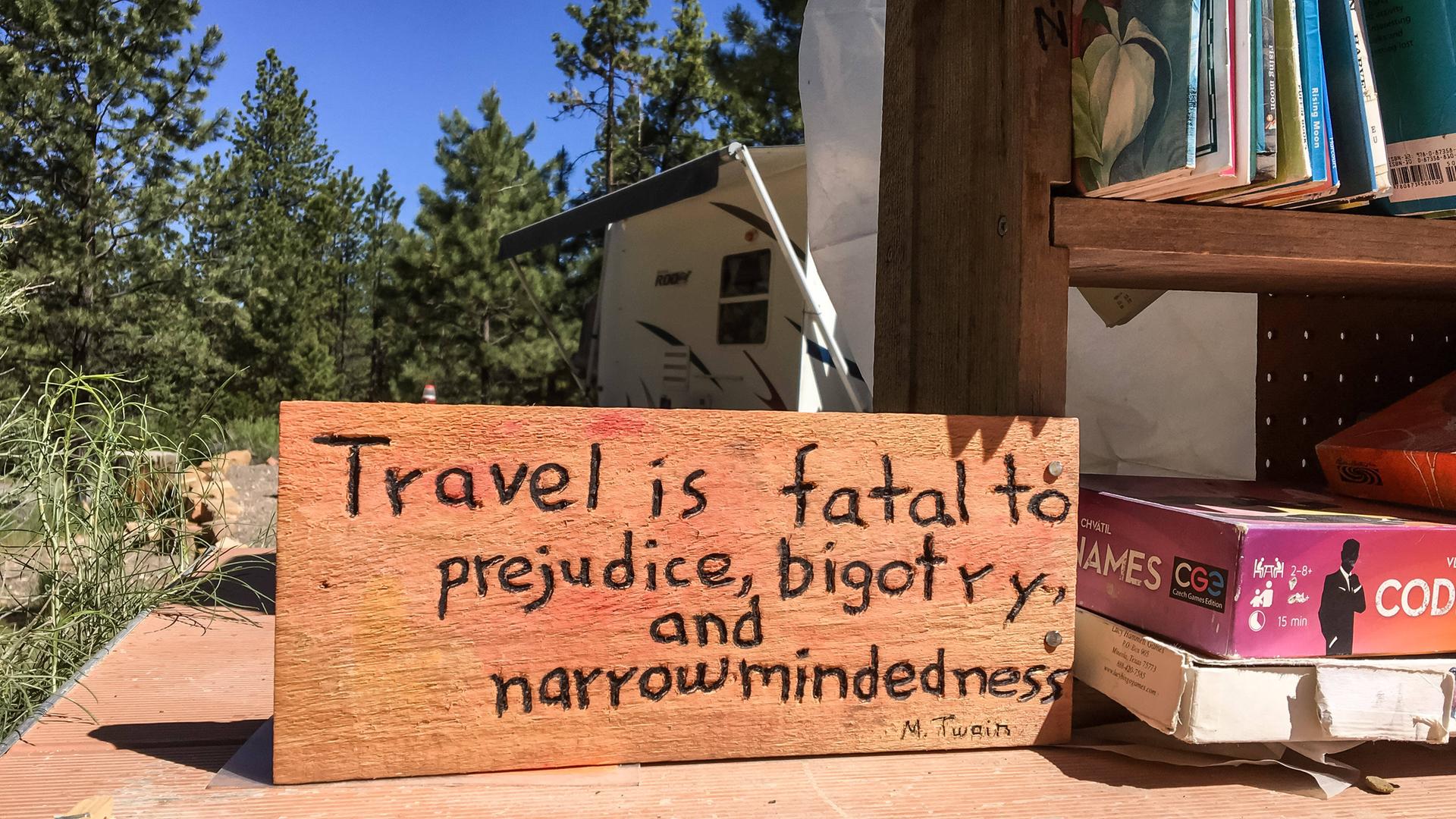
Das Genre bot Stoff für interessierte Traveller auf der Suche nach Abenteuern, Fernweh und einsamen Landschaften. Die Weltreise war vorher schon ein literarisches Genre, in dem Jonathan Swift, Selma Lagerlöf, Virginia Woolf und Hans Fallada sich einen Namen machten. Und eine ganze Reihe von reisenden und schreibenden Frauen war im 19. Jahrhundert stilbildend für weibliche Rollenvorstellungen bei der Welterkundung zwischen Orient und Okzident. Thekla Dannenberg macht sich auf die Suche, was in reisekritischen Zeiten aus dem Genre geworden ist.
„Es gab immer einen Strang der Reiseliteratur, in dem die Kehrseite des Genres die Oberhand gewann, das Oberflächliche, Zufällige, Klischeehafte. Eine alte Journalistenregel besagt: Nach sechs Wochen in einem Land kannst Du ein Buch schreiben, nach sechs Monaten mehrere Artikel, nach sechs Jahren nichts mehr.“
Früher wussten wir genau, wie es geht, das Reisen in ferne Länder. Die großen Schriftstellerinnen und Reporter zeigten es uns, Bruce Chatwin, Gabriel García Márquez und Ryszard Kapuściński, Martha Gellhorn und Annemarie Schwarzenbach. Sie durchquerten Patagonien, die Hochebene von Äthiopien oder den Kaukasus, sie nahmen uns mit nach Timbuktu, Jerusalem und Samarkand. Sie waren getrieben von der Sehnsucht nach einem Horizont, der gar nicht weit genug aufgespannt sein konnte. Denn ohne die Ferne bliebe unser Denken und Dasein viel zu beengt. Wer reiste, war Avantgarde.
Diesen Nimbus hat das Reisen lange schon verloren. Der Massentourismus, die Pandemie und die Klimakrise haben das Reisen unter Verdacht gestellt, es ist nicht nur gewöhnlich geworden, sondern schädlich. Im dritten Pandemie-Sommer droht sogar die touristische Infrastruktur in Europa unter Inflation, Personalmangel und dem Andrang der Erlebnishungrigen zusammenzubrechen. Einen Kollaps der überhitzten Reiseindustrie werden nicht alle bedauern.
Klara zum Beispiel war neun Jahre alt, als sie in ihrer Familie einen CO2-neutralen Urlaub durchsetzte. Sie, ihre Eltern und die jüngere Schwester wollten nur elektrisch betriebene öffentliche Verkehrsmittel benutzen, es wurde gezeltet und für Ausnahmefälle gab es drei Joker: Ein Joker erlaubte öffentliche Verkehrsmittel, die mit Diesel oder Benzin betrieben werden, also den Bus oder die Fähre. Klara und ihre Familie kamen immerhin von Bonn bis auf eine holländische Nordseeinsel. Es gibt etliche Familien, die seit Jahren konsequent ihren Urlaub an Nord- und Ostsee verbringen. Schließlich gilt es, die Welt nicht nur im Großen und Weiten zu entdecken, sondern auch im Kleinen und Nahen. Es ist schwer, ein Interesse für die Welt zu behaupten, wenn man fahrlässig dazu beiträgt, sie ein bisschen unbewohnbarer zu machen. Wer reist, hat die Zeichen der Zeit nicht verstanden.
Die Krisen der Welt zwingen uns dazu, alte Gewissheiten zu überprüfen: Bringt das Reisen die Menschen wirklich einander näher? Erweitert es unseren Horizont? Oder dient es nur der Reizbefriedigung, dem Statusgewinn und einem Faible für feudales Setting? Vielleicht müssen wir noch einmal grundsätzlich darüber nachdenken, wie wir die Welt erfahren, wie wir uns in ihr bewegen und schließlich auch, wie wir von ihr erzählen.
Das britische Literaturmagazin Granta, das seit jeher die angesagten Autorinnen und Autoren der englischsprachigen Literatur versammelt, hat im Herbst 2021 zu einer grundlegenden Revision der Reiseliteratur angesetzt. Mit seiner Ausgabe 157 hat Granta das Reisen und das Schreiben darüber auf den Prüfstand gestellt.
"Should we have stayed at home?", fragt die Zeitschrift auf ihrem Titel in Anlehnung an ein Gedicht der Amerikanerin Elizabeth Bishop: Hätten wir zu Hause bleiben sollen? Darunter ist ein Bild der Schweizer Alpen zu sehen, aufgenommen von einer in die Jahre gekommenen Aussichtsplattform. Selten erschien der Reiz der Alpen so verblasst wie auf dieser Fotografie des amerikanischen Autors Teju Cole. Fundamentaler kann man die bisher so positiv konnotierte Welterfahrung nicht infrage stellen.
Was bringt die Zeitschrift dazu? Am Anfang steht eine Erkenntnis, in der auch Enttäuschung mitschwingt: Die Welt sei nicht mehr zu entdecken, schreibt der Herausgeber William Atkins in seiner Einleitung, jedes Land sei bereits erkundet, jeder Flecken Welt bereist und jede Kultur vermarktet:
"Das Amazonas-Becken ist eine rauchende Ruine, der Sand der Arabischen Wüste ist ebenso mit Fußstapfen übersät wie der Strand von Clacton-on-Sea; die Kehlkopf-Sänger von Tuva posten ihre Nummern auf Instagram."
Schwerer jedoch wiegen die politischen Skrupel: Wem dient es, wenn man zum Beispiel wie Atkins selbst in die Uiguren-Provinz Xinjiang reist? Den Menschen vor Ort, dem chinesischen Staat oder doch nur dem Autor beim Ergattern eines Buchvertrags? Eine nachvollziehbare Überlegung, aber William Atkins geht noch weiter.
Die Frage "Hätten wir zu Hause bleiben sollen?", die Granta im Titel zitiert, entstammt dem Gedicht "Questions of Travel". Elizabeth Bishop wägt darin ab, ob unsere Träume nicht ihren Zauber verlieren, wenn wir versuchen, sie zu leben anstatt sie weiterzuträumen.
Was bei Bishop eine persönliche Frage und unentschieden bleibt, ist für Granta‑Herausgeber William Atkins eine ausgemachte Sache mit historischer Dimension:
"Wer zu Hause bleibt, kolonisiert nicht, versklavt nicht, plündert nicht und führt keine Kriege."
Der Satz ist ein Schlag ins Gesicht. Aber nicht nur die Reisenden stellt Atkins in die Reihe von Eroberern und Ausbeutern, sondern auch Reiseschriftstellerinnen und Autoren, die den kolonialistischen Diskurs unreflektiert fortgesetzt hätten. Atkins' schuldbeladener Text ist ein Dokument der Verzagtheit, er hat ihm viel Spott eingetragen. "Too woke to travel write" – zu woke zum Reisen, lästerte das konservative britische Magazin The Critic und fragte schon, ob jetzt die ganze Reiseliteratur gecancelt werden müsste.
Tatsächlich geht auch Atkins hart mit der Reiseliteratur ins Gericht. Er versteht die Granta‑Ausgabe 157 als Zäsur, aber auch als Gegenentwurf zu der legendären Ausgabe vom Frühjahr 1984, in der die Zeitschrift all jene Literaten zusammenbrachte, die uns zu jener Zeit die Welt eröffneten: Martha Gellhorn, Bruce Chatwin, Gabriel García Márquez. Die Illustration auf dem Cover damals zeigte eine mondäne Szenerie: Ein Flugzeug, das in der Wüste bruchlanden musste, davor eine unerschütterte Frau in knallrotem Kostüm, das Halstuch flatternd im Wüstenwind, die Reiseschreibmaschine fest in der Hand. Der Pilot trägt der weltgewandten Reporterin das Gepäck hinterher, nicht zu vergessen die Golfschläger.
An die Zeiten, als das Fliegen noch mit Exklusivität verbunden war, mag mancher mit Wehmut zurückdenken, doch mehr noch als das Cover scheinen die Texte aus der Zeit gefallen: Zum Beispiel der von Martha Gellhorn, der großen Reporterin (und kurzzeitigen Ehefrau von Ernest Hemingway), die schon während des Zweiten Weltkriegs von allen Fronten Europas berichtete. Gellhorn erzählt in ihrer Geschichte "White into Black", wie sie im Jahr 1952 nach Haiti kam, um ein neues Buch zu schreiben. Statt der erhofften karibischen Idylle erlebte sie den deprimierenden Zustand einer kaputt-regierten Insel, beklemmende Voudou-Zeremonien und Kinder, die sie mit Steinen bewarfen, weil sie keine Weißen kannten. Gellhorn war eine aufgeklärte, liberale Intellektuelle, aber ihre Gedanken zu Rassismus, Armut und kultureller Fremdheit können heute bestenfalls als naiv durchgehen.
Noch weniger bestehen kann vor dem heutigen Blick eine Reportage des britischen Star‑Literaten Bruce Chatwin, der im westafrikanischen Benin zufällig einen Putschversuch miterlebte. Die regierungstreuen Soldaten hielten ihn - wie auch andere Europäer - für einen Söldner auf der Seite der Putschisten. Als Beweis diente ihnen, wie Chatwin mokant erzählt, ausgerechnet der schwarze Montblanc-Stift, den Chatwin in seiner Hemdtasche trug. Angeblich konnte der Korporal den Füllfederhalter nicht von einer Waffe unterscheiden.
Am Ende des Tages war der Putsch niedergeschlagen, die Menschen wagten sich wieder auf die Straße und verlangten die Hinrichtung der Putschisten. Chatwin seufzt:
"Nein. Dies war nicht mein Afrika. Nicht dieses verregnete, verdorbene Afrika. Nicht dieses Afrika des blutigen Gelächters. Das Afrika, das ich liebte, war das weite, wellige Land der Savanne im Norden, das Leoparden-gefleckte Land, über das sich, so weit das Auge reichte, Schirmakazien erstreckten."
Abends begossen die Europäer in der Bar die überstandene Gefahr mit einer Flasche Champagner. Krug gab es leider nicht, aber Bollinger tat es auch.
Bruce Chatwin war ein bewundernswerter Reiseschriftsteller, belesen, welterfahren, kunstsinnig, ein eleganter Stilist. Er hat die Geschichte Patagoniens neu erzählt und dabei gezeigt, wie sich die Geschichten der Menschen wie ein Palimpsest übereinanderlegen. Er hat uns mit den Traumpfaden die spirituelle und intellektuelle Welt der australischen Aborigines eröffnet. Das Werk hat viel Kritik auf sich gezogen, weil Chatwin das heilige Wissen der Aborigines für seinen Weltbestseller ausschlachtete. Aber literarisch haben die Traumpfade Bestand.
In der Reportage aus Benin zeigt sich ausschließlich die unsympathische Seite der Reiseliteratur. Chatwin scheint nicht zu bemerken, dass er sich in Benin eben ganz genau so bewegt wie die europäischen Söldner, ominöse Regierungsberater und Geheimdienstler. Er wendet es gegen den Korporal, dass dieser ihn nicht als Schriftsteller erkennt, dabei hätte es Chatwin zu denken geben müssen, dass er in seinem Khaki-Outfit nicht zu unterscheiden war von den anderen Emissären postkolonialer Machtabsicherung.
Die Beispiele, die Granta-Herausgeber William Atkins anführt, sind durchaus schlagkräftig, sie zeugen von einem Chauvinismus, den heute kaum noch jemand akzeptabel fände. Auch von den vielen sprachlichen Klischees und überholten Metaphern sollte sich die Reiseliteratur befreien: von dem unendlichen Nichts, den unentdeckten Welten und natürlich dem Herz der Finsternis. Und dennoch tut Atkins dem Genre der Reiseliteratur auch Unrecht.
Schon in den Tagebüchern, die der französische Essayist Michel de Montaigne auf seiner Reise nach Deutschland und Italien im Jahr 1580 verfasste, erwies sich die Reiseliteratur als ein sehr eigentümlicher Mix aus Selbst- und Fremderfahrung. Aus dem Überdruss am eigenen Land heraus in die Fremde getrieben, nahm Montaigne begierig alle Erfahrungen auf, die ihm das Reisen bescherte, mit großer Begeisterung für das Unbekannte, das Andere schlechthin. Montaigne interessierte sich für Landschaften und städtische Architektur, Religion und Technologie, die Qualität des Weins, die Schönheit der Frauen oder die unterschiedlichen Methoden, einen Banditen hinzurichten. Montaigne verband seine Impressionen mit dem peniblen Protokoll der eigenen Befindlichkeiten, Vorlieben und Antipathien. Seinen Sekretär lässt er gewissenhaft notieren:
"Die Deutschen haben die gute Eigenschaft, vom ersten Wort an zu sagen, welchen Preis sie verlangen: Handeln hat da wenig Zweck. Sie sind zwar Prahlhänse, Choleriker und Trunkenbolde, aber, sagte der Herr de Montaigne, weder Betrüger noch Spitzbuben."
Die Italiener machen bei ihm weniger Eindruck:
"Der Herr de Montaigne sagte, bisher keinem Volk begegnet zu sein, wo man schöne Frauen so selten zu Gesicht bekäme wie in Italien. Zudem fand er die Gasthäuser viel ungastlicher als in Frankreich und Deutschland: Es wird weniger üppig getafelt, die Portionen sind nur halb so groß wie in Deutschland, und die Speisen nicht so gut zubereitet. In beiden Ländern verzichtet man darauf, den Braten zu spicken, in Deutschland ist er jedoch besser gewürzt und mit Soßen und Gemüsen angereichert."
Immerhin räumt er ihnen einen Vorzug ein:
"Worin uns die Italiener vor allem übertreffen, ist der Reichtum an sehr schönen Pferden."
Montaignes Eindrücke scheinen – heute betrachtet – ziemlich schräg, sie sind unverkennbar subjektiv, seine Urteile mal launig, mal launisch und in ihren Verallgemeinerungen kaum haltbar. Oberflächliche Anschauung paart sich mit profunder Einsicht. Und doch zeugen diese Beobachtungen auch von der Lust an der Erfahrung, von der Bereitschaft, sich selbst der Fremde auszusetzen. Das Ich, der Andere und die Welt treffen in Montaignes Reisebericht voller Erwartung zusammen.
Auch die Schweizer Schriftstellerin Annemarie Schwarzenbach war eine große Reisende. In den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts suchte sie das Aufregende, das Große und fand es auf ihren zahlreichen Orientreisen nach Damaskus, Bagdad und Istanbul. Sie fuhr mit dem Auto bis nach Afghanistan, über die windigen Bergketten des Hindukusch, von Herat nach Kabul und vorbei an den Buddha-Statuen von Bamiyan. Je klangvoller die Namen der Orte, die sie erreichte, umso tiefer berührten sie ihr Herz. Aber Schwarzenbach war auch überzeugt, dass das Reisen, die Erfahrung der Welt, ein grundsätzlicher, ein existenzieller Gewinn sei: Unser Denken und unser Dasein blieben zu eng gefasst, wenn wir nicht die Erfahrung des Reisens darin einschlössen, schreibt sie in ihrer Reportage über die zentralasiatische Steppe:
"Wir nennen Wirklichkeit nur, was wir mit Händen greifen können, und was uns direkt betrifft – und leugnen die Gewalt des Feuers, wenn es schon brennt im Nachbarhaus, aber nicht bei uns. – Krieg in anderen Ländern? – Zwölf Stunden, zwölf Wochen nur von unseren Grenzen entfernt? Gott behüte, das Grauen, das uns manchmal ankommt, man verspürt es auch beim Lesen von Geschichtsbüchern. Zeit oder Raum, es bleibt sich gleich, was immer uns davon trennen mag. Die Reise aber lüftet ein wenig den Schleier über dem Geheimnis des Raums – und eine Stadt magisch-unwirklichen Namens, Samarkand die Goldene, Astrachan oder Isfahan, Stadt des Rosenöls, wird wirklich im Augenblick da wir sie betreten und mit unserem lebendigen Atem berühren."
Schwarzenbach war eine Ausnahmegestalt der europäischen Literatur. Als Tochter einer vermögenden Schweizer Industriellenfamilie genoss sie die Freiheit, sich keinem Rollenbild fügen zu müssen. Sie verkehrte in den Künstlerkreisen um Klaus und Erika Mann und pflegte dezidiert keinen Sinn für weibliche Tugenden. Ihre Reportagen sind durchdrungen von dem Wunsch, dem faschistischen Europa zu entfliehen, aber auch der eigenen Unruhe. Hinter ihrer Abenteuerlust steckte wie bei vielen Reisenden eine gehörige Portion Eskapismus, auch Egozentrik und Hedonismus.
Es gab immer einen Strang der Reiseliteratur, in dem die Kehrseite des Genres die Oberhand gewann, das Oberflächliche, Zufällige, Klischeehafte. Eine alte Journalistenregel besagt: Nach sechs Wochen in einem Land kannst Du ein Buch schreiben, nach sechs Monaten mehrere Artikel, nach sechs Jahren nichts mehr.
Mark Twain zum Beispiel war durch und durch Journalist. 1867 nutzte er die Pilgerfahrt einer amerikanischen Kirchengemeinde für eine Reihe von Zeitungsberichten, die später auch als Buch erschienen: Unterwegs mit den Arglosen lautete der unbekümmerte Titel. Twain reiste mit seiner Gemeinde auf einem Passagierdampfer durchs Mittelmeer, von Tanger über Marseille, Neapel und Athen, Konstantinopel und Odessa bis nach Jerusalem.
Doch Mark Twain reiste ohne Vergnügen; Erlebnisse und Begegnungen boten ihm vor allem Anlass für Lästereien. Tanger war für ihn der "infernalischste" Ort, den er je gesehen hatte, Paris eine schmutzige Lumpenstadt, und Jerusalem ein Hort von Aussätzigen, Krüppeln, Blinden und Schwachsinnigen. Mitunter schimmert in seinen Texten ein Hauch von Selbsterkenntnis durch:
"Überall starrten uns die Menschen an, und wir starrten zurück. Wir gaben ihnen auch meist das Gefühl, unbedeutend zu sein, ehe wir mit ihnen fertig waren, denn wir blickten mit amerikanischer Größe auf sie herab, bis wir sie zurechtgestutzt hatten. Und doch fanden wir Gefallen an ihren Sitten und Gebräuchen und besonders an den Moden der verschiedenen von uns besuchten Völkern… In Konstantinopel putzten wir uns prächtig heraus! Turbane, Krummsäbel, Feze, Jagdpistolen, Tuniken, Schärpen, Pluderhosen, gelbe Pantoffeln. Wie herrlich wir aussahen!"
Der Tourist bot schon immer ein schauerliches Bild, wenn er sich der Folklore hingab. Mark Twain erspart seinen Spott niemandem, er verteilt seine Frotzeleien und Bosheiten gleichermaßen auf seine Mitreisenden wie auf die Bewohner der mediterranen Welt. Und auch wenn ihm dabei durchaus scharfsinnige Beobachtungen gelingen, so dienen ihm seine Erlebnisse doch vor allem als der Hintergrund, vor dem er humoristisch brillieren kann.
Ernster wird es bei einem Schriftsteller wie dem Briten Evelyn Waugh, der 1931 in seinen Expeditionen eines englischen Gentleman von Reisen durchs östliche Afrika berichtet.
In eleganter Prosa erzählt Waugh von der prunkvollen Krönung des äthiopischen Kaisers Haile Selassie, zu der alle Königshäuser Europas ihre Abgesandten schickten, oder von der Schönheit der kenianischen Savanne, die seiner Ansicht nach jedoch erst durch die Kaffeeplantagen der britischen Siedler ihre Vollkommenheit erlangte. Es ist für den Briten selbstverständlich, dass er auf seiner Reise stets von örtlichen Hoheiten empfangen wird.
Waugh ist ein gebildeter Schriftsteller, er reflektiert die Sinnhaftigkeit des britischen Imperialismus, und doch schaudert einen beim Lesen, wenn Waugh mit dem harten Blick seiner Zeit die Lage von Afrikanern, Arabern und Indern etwa auf Sansibar beschreibt.
"Was bei den Eingeborenen anständige, primitive Einfachheit ist, ist bei den indischen Einwanderern Verwahrlosung. Während die Eingeborenen ihre Stammesloyalitäten haben und mit ihrer natürlichen Umgebung durch ein ausgeprägtes Ordnungssystem verbunden sind, haben die ostafrikanischen Inder weder Wurzeln noch Frömmigkeit. Die Araber sind von Hause aus gastfreundlich und großzügig und wahre 'Gentlemen', insofern sie Wert auf Müßiggang legen. Durch die Pax Britannica ihres traditionellen Lebensstils beraubt, verkommen ihre Eigenschaften zu Dekadenz und Faulheit, wie das bei jeder verantwortungslosen Aristokratie zu beobachten ist."
Und so geht es weiter. Im Vorbeireiten werden Stammesmentalitäten klassifiziert, während man selbst recht gut gepolstert im Sattel sitzt. Bei Waugh tritt der kolonialistische Charakter offen zu Tage, der dem Reisen eben auch zugrunde liegen kann und der die Tourismusindustrie in vielen Ländern bis heute antreibt. Der Reiz des Reisens in ferne Länder bestand immer schon in seinem patrizischen Charakter.
Was ein elitärer Engländer wie Evelyn Waugh als Selbstverständlichkeit hinnimmt, stürzt einen Autor wie den Hamburger Helge Timmerberg in die Verzweiflung. Timmerberg ist durchaus auch den sinnlichen Freuden zugeneigt, Hedonismus ist ihm nicht fremd. Schließlich ist er ein alter Hippie, wie er in seinen Büchern betont. Er schwärmt vom Prunk kolonialer Architektur und von der Schönheit afrikanischer Frauen. Aber er begegnet Menschen stets in großer Offenheit, mit echter Kameradschaftlichkeit. Wenn er daher in Malawi in einer Luxus-Lodge am Lagerfeuer sitzt, muss ihm unbehaglich werden, wie er schon 2012 in seinem Buch African Queen schrieb:
"Paradiesischer Strand, braver Busch, die Gäste und die europäischen Mitarbeiter der Lodge, oder soll ich gleich sagen: die Weißen, sitzen in großen Stühlen im Halbkreis um das Feuer, und die Einheimischen hocken in der Lodge-Uniform (kurze, blaue Hose, beiges Poloshirt mit blauem Bund) hinter der Bar und warten auf ihren Zuruf. Für sie ist das normal. Das war bei ihren Vätern so, bei ihren Großvätern und Urgroßvätern ebenso. Schwarze bedienen Weiße, und obwohl die Lodge von ehemaligen Unesco-Mitarbeitern zum Benefit der Afrikaner aufgebaut worden ist, wirkt das scheißkolonial. Massentourismus ist der moderne Kolonialismus, Individualtouristen sind die Pioniere, Reisejournalisten die Entdecker."
Timmerberg zeigt mit seinem Buch African Queen schön deutlich, in welchen politischen, historischen und emotionalen Schlamassel man sich reisend begibt. Hätten wir also doch zu Hause bleiben sollen? Oder reicht es, besser zu reisen und bedachter zu schreiben?
Sehen wir uns an, was die Granta-Autoren der klassischen Reiseliteratur entgegensetzen, denn schließlich will das Heft 157 nicht nur abrechnen, sondern auch den Weg in die Zukunft weisen.
Es sind ernste, nüchterne Texte, mal klingen Hilflosigkeit oder Verzweiflung durch, mal Selbstgewissheit und Überheblichkeit. Poesie, Wissenschaft und Aktivismus stehen nebeneinander, gehen ineinander über oder konterkarieren sich.
Einige Beiträge ragen heraus, sie sind von einem unerschütterlichen Interesse an der Welt getragen.
Ein berührender Text kommt von dem jamaikanischen Autor Jason Allen-Paisant, er liest sich zu Beginn wie die klassische Coming-of-Age-Geschichte eines jungen Dichters. Aufgewachsen bei seiner alleinerziehenden Mutter in einem abgelegenen Dorf auf Jamaika, verliebt sich der Junge in eine französische Aussteigerin, die ihm Französisch beibringt, die Liebe und die Musik von MC Solaar. Die fremde Sprache war seine Zuflucht, wie Allen-Paisant schreibt:
"Ich war gut zwölf Jahre alt, als meine kleine Schwester auf die Welt kam, meine Mutter ein weiteres Mal verlassen wurde, und das Haus zu einem Ort des Schreckens wurde. Ich musste dem entkommen, und die Sprache war mein Weg. In meiner Vorstellung gibt es eine enge Verbindung von Sprache und Landschaft. Beide sind imaginär und doch physisch. Sprache ist ein Ort. Ich kann ihren Körper spüren. Ich kann ihre Dichte spüren, wenn ich in ihr versinke."
Die Emphase, mit der Jason Allen-Paisant die Liebe, die Sprache und die Fremde beschwört, spiegelt sehr schön das dichterische Erwachen, wie es in der europäischen Literatur so oft besungen wurde - allerdings mit einem gravierenden Unterschied: Die Ferne, in die Allen-Paisant schließlich gelangt, gibt ihm immer das Gefühl der Zweitklassigkeit. Er kommt nicht nach Frankreich, sondern nach Großbritannien: Im Park von Leeds muss er Platz machen, wenn ihm eine Engländerin begegnet, damit sie keine Angst vor ihm bekommt.
"Man rechnet hier nicht mit mir. Und weil ich das ahne, beginne ich meinen Körper zu beobachten und zu regulieren, ich muss Raum geben. Mitten im Nirgendwo macht der schwarze Mann Platz für die weiße Frau. So wird Landschaft erschaffen, sie ist, was wir aus einem Ort machen. Welche Geschichten wir uns über ihn erzählen, welchen Platz wir ihnen einräumen und dann sagen, dies ist unsere Landschaft."
Jason Allen-Paisant verbindet Landschaft und Sprache auf poetische Weise, aber mit einer bitteren Note. Seine Erfahrung als Jamaikaner in einem englischen Park zeigt, dass am Ende doch ein Unterschied besteht zwischen den Erfahrungen eines Jamaikaners mit Fernweh und einem westlichen Autor. Weiße fallen in afrikanischen Ländern auf, werden vielleicht von Kindern umringt, aber sie werden sich selten diskriminiert fühlen. Sie nehmen die Aufmerksamkeit eher wie eine Huldigung entgegen.
Die amerikanische Historikerin Bathsheba Demuth wiederum erzählt von ihrer Reise auf die Halbinsel Tschukotka im Fernen Osten Russlands. Von hier aus ist über die Beringsee hinweg die Küste Alaskas zu sehen. Tschukotka ist militärisches Sperrgebiet, aber auch die Heimat der Tschuktschen, einer indigenen Nation, die von der Rentierzucht und dem Walfang lebt. Die internationale Walfangkommission erlaubt ihnen, 140 Tiere im Jahr zu töten, schließlich waren nicht sie es, die die Bestände in zwei Jahrhunderten unbarmherziger Jagd dezimierten. Es waren zuerst die Walfänger aus Neuengland, dann die Flotten der Sowjetunion. Erst zeigte der entfesselte Kapitalismus den Tschuktschen, was Fortschritt ist, erbost sich die Autorin, dann der ungezügelte Sozialismus.
Die Menschen in Tschukotka lieben die Wale nicht, sie leben mit ihnen. Sie essen das nahrhafte Fleisch, kurieren ihre Krankheiten mit dem Fett und verwenden das Skelett für den Bau ihrer Siedlungen, wie Demuth erzählt:
"Ich krieche auf dem Bauch in eine der Hütten, um sie mir genauer anzusehen. In der Dunkelheit erkenne ich die helle schwere Stirn eines Walschädels. Er trägt die Erde, eine Wand aus Knochen. Die Menschen hier leben in den Köpfen der Wale."
Ein Meer mit reichen Fischbeständen verschafft den Menschen genug Kalorien zum Sesshaftwerden, die karge Tundra dagegen erfordert ein nomadisches Leben. Demuth erzählt von dieser Welt mit Bedacht und Präzision, sie verbindet ihre Beobachtungen mit Reflexionen über die Moderne, den Umgang mit Ressourcen und die Frage, wie die Natur die Ökonomie prägt und umgekehrt die Ökonomie unser Naturverständnis.
Am Ende spricht sie sich kategorisch dagegen aus, auf das Reisen, die eigene Erfahrung der Welt zu verzichten. Urteile aus der Distanz zu fällen, sei einfach, meint Demuth, doch nur aus der Nähe erfasse man die Realität eines Ortes und kann ermessen, welches Leben die Umgebung erzwinge.
"Es ist leichter – nicht notwendig, aber leichter – aus der Distanz heraus und ohne eigenes Interesse, umfassende Aussagen über die Geschichte und die menschliche Natur zu treffen. Mir wurde beigebracht, in dieser Mühelosigkeit nicht eine Beschränkung zu sehen, sondern einen Vorzug: Weit weg zu sein bedeutet objektiv zu sein, definieren zu können, was ist und was war und was richtig ist."
Demuth argumentiert als Wissenschaftlerin gegen einen abgehobenen Erkenntnisbegriff und für das Reisen. Sie zielt auf die alten Propagandisten der Moderne und des Fortschritts, trifft aber auch alle heutigen Verfechter einer Universalmoral.
Die neue Reiseliteratur, die das Granta-Heft also vorstellt, folgt keiner geschlossenen Programmatik. Die alten Triebkräfte des Reisens spielen in dieser Literatur kaum eine Rolle: Die Magie der Welt, der Rausch des Alleinseins oder die Lust am Missverständnis.
Die Schriftstellerin Felicitas Hoppe beschrieb den Reiseroman einmal als eine Form des modernen Ritterromans, in dem es gelte loszureiten, um die Abenteuer auf sich zukommen zu lassen.
Die Autorinnen und Autoren der neuen Reiseliteratur suchen nicht das Abenteuer, sondern die Erfahrung, manchmal vielleicht auch nur Beweise. Sie wollen unser Wissen um den Zustand des Planeten vergrößern, nicht der Welt einen neuen Zauber verleihen. Das ist ernüchternd, nicht nur im Positiven: Die Begegnung mit Menschen spielt in dieser Reiseliteratur selten eine Rolle, neue Wege für ein Miteinander, solidarische Verbindungen und bleibendes Engagement eröffnet sie nicht.
Das Granta-Heft nimmt uns die unbedarfte Freude am Reisen, das ist nicht schlimm. Aber wappnet es uns auch dagegen, den Geist zu verschließen? Denn darauf müsste es ja ankommen, wie schon Annemarie Schwarzenbach von einem weisen Inder lernte: Morgens beim Aufwachen nicht an sich selbst zu denken, sondern an die Welt.










