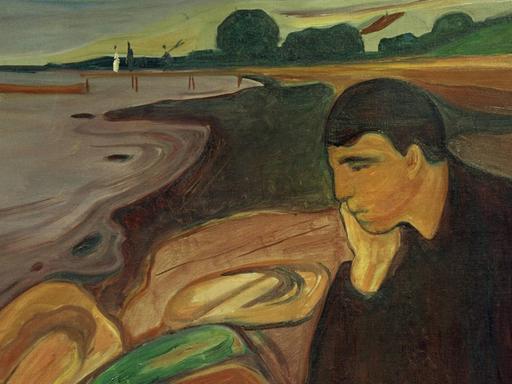In einer Weltbank-Studie aus dem Jahr 2011 wurde geschätzt, dass in Kenia auf 950 Menschen ein Heiler kommt, aber nur ein Arzt auf 33.000 Kenianer. In Deutschland kamen im Jahr 2020 auf 1000 Einwohner 4,5 Ärzte. Die bloße Zugänglichkeit macht traditionelle Heiler zu einer praktikableren Option.
Obwohl die Mehrheit der Menschen in Afrika traditionelle Medizin nutzt, ist sie in vielen afrikanischen Ländern illegal. Was wäre, wenn man beginnen würden, von „elementarer Gesundheit“ zu sprechen? Und damit die psychische Gesundheit ebenso zu berücksichtigen wie die Rolle von Beziehungen und der Gemeinschaft als Grundlage für das individuelle Wohlbefinden? Könnten solche Begriffe dazu führen, die moderne medizinische Vorstellungskraft zu erweitern und den Rahmen dafür zu verschieben, was die wirksamste Medizin ausmacht?
Die Bewertung der traditionellen Medizin vertieft die Fragen, welche Kriterien man an Gesundheit, auch mentale Gesundheit, anlegt; wie traditionelles Wissen bewahrt und weitergegeben werden kann in einer Welt, die von der leistungsstarken westlichen Medizin dominiert wird. Und sie führt zu Fragen des Kolonialismus zum Beispiel in Afrika zurück. Oft war traditionelle Heilkunst für die Kolonisatoren nichts anderes als Hexerei.
Priya Basil, geboren 1977, ist „eine britische, kenianische, indische, in Deutschland lebende Schriftstellerin, deren Leben nicht zwischen zwei Buchdeckel passt, da es einfach zu unglaublich ist“, so schrieb das Magazin „Wired“. Sie ist unter anderem eine Initiatorin des Aufrufs „Die Demokratie verteidigen im Digitalen Zeitalter“ und Mitgründerin des Aktionsbündnisses „Wir machen das. Für eine postmigrantische Gesellschaft“. Zwischen zwei Buchdeckel passt u.a. ihr Roman „Die Logik des Herzens“ (2012), ihr Buch „Gastfreundschaft“ (2019) oder „Im Wir und Jetzt – Feministin werden“ (2019).
Wo lang jetzt? Wir suchen den Straßenrand nach Schildern zu einem Ort ab, der auf keiner Karte eingezeichnet ist. Mein Smartphone behauptet zu wissen, wo wir uns gerade befinden. Unsichtbare Signale werden zurückgeworfen, stellen eine Verbindung her, informieren die Ortungsdienste: Die Welt, zusammengeschrumpft zu einer Reihe von Koordinaten, einer Stecknadel, einem pulsierenden blauen Symbol, das bestätigt: Sie sind hier, in der Nähe der Stadt Malindi. Aber was nützt schon eine Position, wenn man sich nicht orientieren kann?
Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation sind rund 80 Prozent der Weltbevölkerung bei der Gesundheitsversorgung auf traditionelle Medizin angewiesen. Die Bedeutung dieses Wissens ist unter zahlreichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern seit Langem anerkannt. Ich versuche, mich dieser Realität anzunähern, zu verstehen, was überdauert hat – wie, weshalb?
Wenn es in meiner indischen Familie eine Tradition in medizinischen Dingen gab, dann war es das Austeilen von Tabletten. Schmerzmittel wurden beim ersten Stechen‑Pochen-Ziehen gereicht: Nicht abwarten! Nimm gleich eine Para. Medikamente hatten Spitznamen; schließlich kannten wir uns nur zu gut aus, dank meiner Großeltern, in deren Küche es ein Regal voller Arzneimittel gab, eine wahre Apotheke inmitten von Gewürzen und Hülsenfrüchten. Es verhieß Linderung für jedes Wehwehchen. Wenn es ernst wurde, kamen Antibiotika-Reste zum Einsatz, Überbleibsel einer abgebrochenen Behandlung.
Der Weltgesundheitsorganisation zufolge ist traditionelle Medizin „die Gesamtheit der auf den Lehren, Glaubensvorstellungen und Erfahrungen verschiedener Kulturen basierenden Kenntnisse, Fertigkeiten und Methoden – unabhängig davon, ob sie erklärbar sind oder nicht –, die zur Gesunderhaltung sowie zur Vorbeugung, Diagnose, Besserung oder Behandlung von körperlichen und psychischen Erkrankungen angewandt werden“.
Schließlich weist uns die Erinnerung den Weg. „Wir müssen die Piste da nehmen“, sagt Mary Bitta, die Wissenschaftlerin, die schon mal dort war und diesen Besuch arrangiert hat. Ich lege mein Handy zur Seite und komme mir dumm vor, weil ich glaubte, mich darauf verlassen zu können. Hier bin ich von anderen und deren Orientierung - Freundlichkeit - Fachkenntnis abhängig, von Bitta etwa, der Gründerin und Leiterin von Difu Simo, einer Kampagne für psychische Gesundheit in Kilifi County, Kenia.
Biomedizin, im Deutschen häufig auch als „Schulmedizin“ bezeichnet, ist „ein Rahmen, eine Reihe von philosophischen Verpflichtungszusagen, eine mit der westlichen Kultur und ihrer Machtdynamik verwobene globale Institution und anderes mehr“. Kurz gesagt, schreibt Sean Valles in seinem Eintrag zu „Philosophie der Biomedizin“ in der Stanford Encyclopedia of Philosophy, ist es „die Bezeichnung dafür, wie sich die meisten mächtigen globalen Institutionen die Beziehung zwischen Biowissenschaften und Medizin vorstellen“.
Ist es diese dominante westliche Realität, die mich entscheidend geprägt hat, obwohl ich in Kenia aufgewachsen bin?
Wir sind da, und sie kommen – alte Männer, alte Frauen. Sie treten aus provisorischen weißen Segeltuchzelten heraus, auf denen „Rotes Kreuz Kenia“ steht; aus festen, kegelförmigen Hütten aus langen getrockneten Grashalmen, die mit Schnüren an ein Gerüst aus Pfosten und Stangen gebunden sind. Sie kommen, um uns in Empfang zu nehmen.
Alles ist vertraut und fremd zugleich, wie ein Echo, das man nicht genau verorten kann. Ich versuche, es zu begreifen, ohne mir die Frage zu stellen: Warum geht es ums Wissen? Könnte Nichtwissen nicht auch nützlich sein?
Wir versammeln uns in einem schiefen Kreis, kurz vereint durch eine Beschwörungsformel, die von einem spirituellen Führer auf Kigiryama, der Sprache der Giryama, vorgetragen wird. Er ruft Worte, und die Runde antwortet mit ausgestreckten Armen die Handflächen zum Himmel aufgedreht. Die Gesten entfalten eine Aura des Glaubens, die flüchtig aufscheint und wieder davongleitet, während ich mich frage, ob ich an … woran eigentlich glaube?
Inzwischen bin ich keine Jüngerin der Arzneimittelausgabe mehr. Zwar beeindrucken mich die heilenden Kräfte der Biomedizin immer wieder aufs Neue, doch im Laufe der Jahre habe ich auch deren Grenzen erfahren müssen, am - im - mit dem eigenen Leib und dem anderer. Und doch ließ mein Wunsch nach der Allheilpille nicht nach; einer Pille, die nicht nur wieder gesund macht, sondern die auch die Vergangenheit in Ordnung bringt.
Meine Großeltern gehörten zu den vielen Inder:innen, die Anfang des 20. Jahrhunderts, in der Blütezeit des britischen Empire, nach Ostafrika auswanderten, um für die dortige Kolonialverwaltung zu arbeiten. Kolonisierte Menschen, die kamen, um – wissentlich, unwissentlich? – ihren Kolonisatoren dabei behilflich zu sein, andere zu kolonisieren. Meine Vorfahren traten einer segregierten Gesellschaft bei, wurden in die Mitte einer rassifizierten Rangordnung geschoben, die Weiße über alle anderen stellte und Schwarze nach ganz unten verdammte. Unterdrücker und Unterdrückte – so sah ich später die Inder in Kenia, einschließlich meiner Familie.
Nach dem Giryama-Begrüßungsritual löst sich der Kreis auf, um sich gleich wieder neu zu formieren: Plastikstühle und Holzhocker werden nur ein paar Meter weiter unter dem ausladenden Dach des Mkone-Baums aufgestellt; alle nehmen im Zirkel seines Schattens Platz. Die Ältesten, darunter einige traditionelle Heiler und Heilerinnen, leben inzwischen gemeinsam in einem kleinen Compound am Rande von Malindi.
Der Körper, dachte ich immer, ist ein einziges Chaos. Nicht, dass es sich mit dem Geist anders verhält, doch Körper – mit ihren Geräuschen - Gerüchen - Sekreten – schüchterten mich ein. Aus dieser sumpfigen, pulsierenden Tiefebene des Daseins versuchte ich in die, so glaubte ich, erhabenen Lande des Geistes zu fliehen, als ließe sich das eine vom anderen trennen, als hätte nicht auch der Geist seine eigenen Moore und Täler. Dann fing ich an, mich mit Kolonialismus, Rassismus, Feminismus, Kapitalismus – und deren Schnittpunkten – zu beschäftigen, und mit einem Mal war der Körper ganz zentral. Welche Körper sind welchen Formen von Zuwendung - Gewalt -Pflege ausgesetzt oder haben Anspruch darauf? Was bedeutet das für diese Körper, diese Köpfe, innen wie außen?
Wenn meine Familie Unterdrücker und Unterdrückte waren, was war dann ich? In seinem Buch The Implicated Subject skizziert Michael Rothberg „eine Figur, die weder der kriminell verantwortliche Akteur ist noch ein bloßer unschuldiger Zeuge von Gewalt“. Das trifft das Dilemma meiner Familie noch genauer, doch erst nach der Lektüre von Tessa Morris-Suzukis Studie The Past Within Us konnte ich mich selbst als eine solche Figur sehen:
„Wir sind in Strukturen, Institutionen und Ideengeflechte verstrickt, die von der Geschichte hervorgebracht und durch fantasievolle, mutige, großzügige, gierige und brutale Taten früherer Generationen geformt wurden […] Wir mögen vielleicht nicht verantwortlich sein […], da wir sie nicht verursacht haben, doch sind wir in sie ‚verwickelt’, da sie uns verursachen.“
Meine Eltern hatten keine Schwarzen Freundinnen und kaum eine Handvoll weißer Freunde. Bei mir war es genauso. Wir lebten abgeschnitten von weiten Teilen der kenianischen Gesellschaft, den Blick sehnsüchtig Großbritannien zugewandt. Später sollte ich dort studieren und leben, bevor ich nach Deutschland übersiedelte.
Für das Volk der Giryama, wie für viele andere in Afrika, ist der Mkone seit jeher ein bedeutsamer Baum; aus dem Holz seines Stamms werden Pfähle für den Hausbau oder Schnitzereien zur Ahnenverehrung hergestellt; Wurzeln, Blätter und Rinde finden in der traditionellen Medizin Verwendung.
Joseph Karisa Mwarandu, ein Rechtsanwalt, verspätet sich, fügt sich aber mühelos in den Kreis ein: „So wie ein Baum seine Wurzeln braucht, um zu gedeihen“, sagt er, „so braucht, glauben wir, ein Volk seine Kultur, um zu gedeihen.“ Mwarandu ist Generalsekretär des Kulturvereins im Bezirk Malindi, Gründer der Kiuye-Uye-Bewegung zur Wiederbelebung der Giryama-Kultur. „Leider sind wir an einem Punkt angelangt, an dem die Leute Angst haben, ihre eigenen Traditionen zu erlernen, aus Sorge, sie könnten als Hexen gebrandmarkt werden. Und Älteste, die traditionelle Kulturen pflegen, riskieren, als witch doctor, sozusagen als ‚Medizinmann’, zu gelten“, erklärt er mir. „Wir sind bemüht, sie vor diesem Schicksal zu bewahren“ – er deutet auf die Runde, fügt dann hinzu: „Wir befürworten keine Hexerei, aber wir schützen diejenigen, die deswegen bedroht sind.“ Ich denke über die Bedrohung nach, ertappe mich aber bei der Frage nach dem Unterschied zwischen traditioneller Medizin und Hexerei. Mwarandu sagt: „Diese Wissensformen lassen sich nicht wissenschaftlich messen oder definieren. Dasselbe Wissen, das als ‚traditionell’ gilt, wenn es zum Wohl eines Einzelnen oder einer Gemeinschaft eingesetzt wird, kann ‚Hexerei’ heißen, sobald es zum Schaden eingesetzt wird.“
Er führt die Misere seiner Community auf den Kolonialismus zurück. Die britischen Kolonialherren erachteten indigene Bräuche als böse, hielten traditionelle Medizin für Hexerei. Er sagt: „Fremde Einflüsse haben unsere Kultur hinweggespült.“ Er redet so, als wäre mir dieser Teil der Geschichte unbekannt. Etwas in mir denkt: Ich kenne mich aus, ich bin ein Produkt des britischen Herrschaftsprojekts; meine Familie wurde von imperialen Kräften gemacht und zunichtegemacht. Etwas Anderes in mir denkt: Er hat recht, ich habe keine Ahnung. Die Geschichte des Kolonialismus ist immer anders, auch wenn es ein und dieselbe ist.
Dieser Tag markierte den Beginn einer Reise, auf der ich das Verständnis von psychischer Gesundheit in verschiedenen kulturellen, sozialen, historischen Kontexten erforschen würde. In den darauffolgenden Wochen sollte ich Dutzende Menschen in Kenia befragen, was sie unter dem Begriff „psychische Gesundheit“ verstehen und ob sie je eine mganga, eine traditionelle Heilerin, aufgesucht haben oder aufsuchen würden.
Expert:innen dieser Art sind auf die Behandlung verschiedener Leiden spezialisiert, etwa auf Probleme im Zusammenhang mit mapenzi (Liebe), biashara (Geschäfte), shango (Gebärmutter). Dass traditionelle Heiler nach wie vor attraktiv sind, liegt laut Studien unter anderem daran, dass sie sich mit Aspekten befassen, die die westliche Medizin ausklammert, Pech zum Beispiel oder Fragen rund um (mangelnden) Erfolg in Beruf oder Studium, Liebe oder Politik.
Gleichwohl beantworteten viele, mit denen ich sprach, die Frage nach Besuchen bei solchen Heilerinnen und Heilern ausweichend: „Ich selbst nicht, aber ich kenne jemanden.“
Die Reaktionen auf den Begriff mental health – auf Deutsch „psychische“, „mentale“, „seelische“ oder „psychosoziale“ Gesundheit – waren einheitlicher und spiegelten eine auch in London und Berlin weit verbreitete Sichtweise wider: Für die meisten bedeutet er etwas Negatives, ein Gebrechen. „She’s got mental health“ ist in Kenia ein alltäglicher Ausdruck, der bedeutet, dass jemand Ängste hat oder depressiv ist. Nur wenige assoziierten den Begriff spontan mit Wohlergehen. Boniface Chitayi, ein Psychiater in Nairobi, sagte, er bevorzuge den Begriff afya ya akili, Gesundheit oder Wohlbefinden des Gehirns. Diesen Aspekt möchte auch Mary Bitta betonen, indem sie das Bewusstsein dafür schärft, dass „mentale Gesundheit bedeutet, in der Lage zu sein, das Leben zu bewältigen“.
„Was heißt das, zu bewältigen?“, frage ich. „Ruhe zu bewahren, während man versucht, eine Lösung zu finden“, sagt sie. Bei Difu Simo arbeitet sie daran, die dafür notwendigen Bedingungen zu verstehen und zu fördern.
Mwarandu sagt noch einmal, dass man die Ältesten habe retten müssen, weil ihr Leben bedroht war und weil sie, ergänzt er, ein Wissen hüten, das nach und nach verschwinde: „Jede und jeder der Ältesten ist eine lebende Bibliothek.“ Was, frage ich mich, wird es wohl bedeuten, sich Wissenssystemen anzunähern, die vom Westen verachtet und marginalisiert worden sind, gegenüber denen mir Skepsis eingeimpft wurde? Was werde ich mit dem Gelernten anfangen können, und was wird es mit mir anfangen?
Der Mkone saugt das Sonnenlicht auf, lässt Schatten über unsere Gesichter und Rücken fließen. Unter dem dichten, grünen Blätterdach lässt sich kaum sagen, wie spät es sein mag. Mwarandu redet weiter. Ich würde ihn gern unterbrechen, zögere aber, weil ihm sonst niemand ins Wort fällt. Schließlich lenkt Bitta Mwarandu sanft in eine andere Richtung: „Vielleicht magst du davon erzählen, wie es mit unserer Zusammenarbeit angefangen hat.“ Und so wird mir endlich klar, welchen Zweck diese Konstellation von Menschen unter diesem Baum hat: Es ist der gemeinsame Versuch, im Dienste der psychischen Gesundheit eine Balance zwischen Biomedizin, traditioneller Medizin und Kultur zu finden.
„Die Kolonisatoren sagten zu den Leuten: Ihr könnt nicht beide Kulturen haben, ihr müsst euch für eine entscheiden. Traditionell oder christlich“, erzählt mir Emanuel Chengo Munyaya, ein Aktivist für die Rechte der Mijikenda und eine Stütze des Rettungszentrums. Als kleiner Junge litt Emanuel an einer Krankheit, die sein Herz unregelmäßig schlagen ließ. Sein Vater, ein traditioneller Heiler, gab ihm ein Amulett, das er unter den Kleidern nahe dem Herzen tragen sollte, und sagte zu ihm: „Wenn du das abnimmst, bevor ich es dir sage, wirst du sterben.“
In der Schule, beim Sportunterricht, nahm ihn der Lehrer, ein Missionar, beiseite: „Morgen will ich das nicht mehr an dir sehen.“
„Aber mein Vater hat gesagt, dass ich sterbe, wenn ich es ablege.“
„Wenn du es trägst, darfst du nicht herkommen“, sagte der Lehrer.
Emanuel ging ein Jahr lang nicht mehr zur Schule. Wegen dieser Unterbrechung stand ihm später kein weiterer Bildungsweg mehr offen. Er verfolgte aber auch nicht das traditionelle Wissen seines Vaters, der starb, ohne etwas davon an ihn weitergegeben zu haben. Eine Zeit lang war Emanuel gestrandet, gehörte weder zur alten noch zur neuen Welt. Eines Tages sagte ein Heiler, ein ehemaliger Assistent seines Vaters, zu ihm: „Ihr jungen Leute werdet immer leiden, weil ihr das Eure verleugnet und dem Fremden folgt.“
Der große Bogen dieser Geschichte ist vertraut, auch wenn sich in den Details Unterschiede zeigen. Kolonialismus funktioniert, indem er verunglimpft - überfällt - zerstört, während er von Völkern - Orten - Kulturen kopiert - stiehlt - profitiert.
Mich unterrichteten, umgaben Menschen, die meinten, hier in Kenia gebe es kaum etwas von kulturellem Wert: Kunst, Ideen, Wissenschaft, Fortschritt, Geschichte, Möglichkeiten – alles Erstrebenswerte war da drüben: im Westen, in Europa. Nie wurde mir das Gefühl vermittelt, etwas davon könnte „das Meine“ sein, aber ich wurde dazu erzogen, dieser Welt entgegenzustreben, sie zu begehren und mich so anzupassen, dass es mir möglich wäre, daran teilzuhaben. Ich gab mir Mühe, dazuzugehören. Man könnte sogar sagen, dass ich gut darin wurde. So gut, dass ich erst sehr viel später anfing zu hinterfragen, was ich verleugnete und anstrebte, was das Meine war und was nicht, und weshalb das alles eine Rolle spielte.
Ich fragte Mary Bitta, was sie von jemandem wie mir halte, die aus Europa hierherkomme, um traditionelle Wissenssysteme zu verstehen. Ob es sich wie eine Form von Bemächtigung, von Extraktion anfühle? Sie sagte: „Ich glaube nicht, dass uns weniger bleibt, wenn du etwas von uns mitnimmst.“ Esther Kamba aber, eine kenianische Künstlerin, der ich von meinen Erkundungen in Sachen psychischer Gesundheit in verschiedenen Kulturen erzählte, sagte: „Ihr habt uns unser Land, unsere Ressourcen, unsere Vorfahren genommen – und jetzt seid ihr auf unsere Spiritualität aus.“ Mir war klar, dass das „ihr“ nicht persönlich gemeint war, aber wieder einmal fühlte ich mich in all das verwickelt.
Im Schatten unter dem Mkone-Baum hätte ich gern gefragt, was die Heiler und Heilerinnen unter psychischer Gesundheit verstehen, wie sie sie behandeln. Doch unbemerkt ließ ich die Gelegenheit verstreichen. In eine andere Welt hinüberzureichen, kann transformativ sein, aber auch heikel, tückisch: Zwangsläufig übersieht - meidet - missversteht man etwas. Später musste ich auf andere Quellen zurückgreifen.
Laut der Forscherin Elialilia Okello und ihres Kollegen Seggane Musisi definiert die traditionelle afrikanische Medizin psychische Erkrankungen als eine Situation, in der die betroffene Person dazu neigt, die Realität auf ungewöhnliche Weise zu interpretieren.
Mir scheint, dass diese weitläufige Definition dazu einlädt, sich mit der Weltsicht und den Umständen der leidenden Person auseinanderzusetzen. Und ich frage mich, ob dieser Ansatz im Kern womöglich von einem anderen philosophischen Ich-Verständnis beeinflusst ist – einem, das sich aus dem afrikanischen Konzept des ubuntu ableitet, was, einfach formuliert, bedeutet: „Ich bin, weil wir sind.“ In diesem Sinne gehört zu jeder Form von Abhilfe, worauf sie im Einzelfall auch gerichtet sein mag, oft auch der Blick über das Individuum hinaus auf das Kollektiv.
Emanuel hatte sich verloren gefühlt, wie andere in seinem Umfeld auch – Jungen und Männer vor allem, die die Schule abgebrochen hatten oder die sich den Besuch nicht mehr leisten konnten. 2023 lag das Durchschnittsalter in Kenia bei 19,6 Jahren. Das sollte eigentlich ein enormes Potenzial verheißen und Anlass zu Optimismus geben, doch Armut – verschärft durch grassierende Korruption, schlechte Regierungsführung und mangelnden sozialen Rückhalt oder fehlende Bildungsprogramme – bedeutet, dass viele junge Leute kaum Perspektiven haben. Manche greifen zu Drogen, andere werden kriminell. Einige fragen sich, warum sie sich abmühen sollen, wenn ihre Familie oder Community doch über Land verfügt; könnten sie nur ein Stück davon verkaufen, dann könnten sie doch bestimmt ein Unternehmen gründen, hätten eine bessere Zukunft, oder?
Bei den Giryama ist Land traditionell Gemeinschaftseigentum, verbunden mit der Verpflichtung, es für künftige Generationen zu bewahren. Tsi Kaiguzwa – das Land darf nicht verkauft werden – ist einer der zentralen Grundsätze des Mijikenda-Gesetzes, untermauert von dieser einen Erkenntnis: Du hast das Land nicht geschaffen, wer also bist du, ihm einen Wert beizumessen oder es zu verkaufen?
„Das Land kann nicht verkauft werden“, sagt Munyaya. „Aber alle in der Community haben das Recht, darauf zu leben und es zu bewirtschaften. Leider fühlen sich die meisten unserer jungen Leute nicht mehr mit dem Land verbunden, sie wollen kein Leben als Landwirt oder Naturschützer. Das staatliche Bildungssystem ist auf Angestelltenjobs ausgerichtet. Das System ist irreführend; es vermittelt den Menschen nicht die richtigen Lebenskompetenzen und lässt sie verloren und deprimiert zurück. Das höchste Ziel vieler junger Männer hier ist ein eigenes boda boda und ein Auskommen als Motorradtaxifahrer. Das ist ihre große Hoffnung, und manche versuchen alles, um sie zu verwirklichen.“
Mary Bitta merkt an, dass der Glaube in der traditionellen Medizin eine wichtige Rolle spiele; wer sich dieser Behandlung anvertraue, spreche vom Glauben an ihre Wirksamkeit; wer sie ablehne, spreche von Aberglauben.
Difu simoheißt „sich befreien“ auf Kigiryama. Das Projekt will der Community dabei helfen, sich von der Stigmatisierung rund um das Thema psychosoziale Gesundheit zu befreien, indem es die Welt der Biomedizin, der traditionellen Heilkunst und der Kultur in Dialog bringt und erforscht, wie ein solcher kombinierter, nicht-konkurrierender Ansatz mehr Menschen dabei unterstützen kann, im Fall von psychischen Erkrankungen eine Behandlung zu erhalten, sie anzunehmen und darauf zu reagieren.
„Beim ersten Schritt geht es darum, das Bewusstsein dafür zu schärfen, was eine psychische Krankheit ist: Angst und Depression gelten als nichts, wofür man Hilfe bräuchte“, so Bitta. „Auf Kigiryama lassen sich Leiden dieser Art mit dem Begriff shulamoyo umschreiben, schweres Herz. Darum muss man sich kümmern, das muss behandelt werden, sagen wir den Leuten, ignoriert das nicht. Wir bemühen uns, verschiedene Kanäle zu öffnen, über die sie Hilfe erhalten können. Manche besorgen sich erst dann Medikamente in der psychiatrischen Klinik, wenn eine traditionelle Heiler:in sie überwiesen hat.“
Der Slogan Difu Simo signalisiert auch eine Chance, sich, zumindest zeitweise, von den Vorurteilen gegenüber dem zu lösen, was „wahre“ - „seriöse“ - „wissenschaftliche“ Sachkenntnis und Methodik ausmacht. „Ich glaube nicht, dass die Biomedizin alle Antworten hat“, sagt Bitta. „Und ich will hier, in meiner afrikanischen Kultur, nach anderen Antworten suchen.“
In meinem Bücherregal in Berlin liegt eine Sammlung von überwiegend grünen Zetteln. Auf jedem steht mein Name, meine Adresse und mein Geburtsdatum. Auf jedem steht das Medikament und die Dosis, das Datum, an dem die Behandlung vorgeschlagen wurde, dazu der Stempel der Arztpraxis und die Unterschrift der Ärztin. Die Daten reichen fast 14 Jahre zurück. Die Rezepte dokumentieren die Besuche bei meiner wunderbaren Hausärztin. Häufig rät sie neben einer medikamentösen Behandlung auch zu einem Naturheilmittel, zu Übungen, einer Umstellung der Ernährung oder Änderungen im Tagesablauf. Manchmal beschließe ich, erst die anderen Optionen auszuprobieren, bevor ich das Medikament einnehme, manchmal befolge ich keine ihrer Empfehlungen; es ist, als würde allein das Beratungsgespräch ausreichen, und schon geht es mir besser. Ist es vielleicht schlicht die Gewissheit, dass nichts Unheilvolles im Gange ist? Oder ist da womöglich eine Art Zauberei am Werk? Die einzigartige Alchemie des mitfühlenden menschlichen Kontakts? Eine geteilte Überzeugung, dass es wieder besser werden kann? „Biomedizinische Praktiken“, bemerkt Megan Vaughan in ihrem Buch Curing Their Ills: Colonial Power and African Illness, „können ebenso ritualisiert und ‚exotisch’ sein wie andere Heilpraktiken auch“.
Einer Studie der Weltbank aus dem Jahr 2011 zufolge kommt in Kenia schätzungsweise ein:e Heiler:in auf 950 Menschen, ein Arzt, eine Ärztin dagegen auf 33.000 Menschen. In Deutschland kamen im Jahr 2020 4,5 Ärztinnen auf 1.000 Einwohner. Allein die Erreichbarkeit macht traditionelle Heilerinnen zu einer tauglicheren Option. Zudem akzeptieren traditionelle Heiler unkonventionelle Zahlungsmittel und nehmen ihr Honorar gern in Raten an: Patient:innen können mit einem Huhn bezahlen oder einer bestimmten Menge Kartoffeln. Meist nehmen sich die traditionellen Heiler und Heilerinnen mehr Zeit als Ärzte und Ärztinnen. Schlägt die Behandlung nicht an, hat man nicht den vollen Betrag zu zahlen.
Außerdem, so Bitta, haben die Menschen bei traditionellen Heilerinnen das Gefühl, die Diagnose aushandeln zu können. Traditionellen Heilern würden die Menschen eher auf Augenhöhe begegnen, meint sie, weil sie derselben Gemeinschaft angehören, sich bereits kennen, Kultur und Geschichte, Erfahrungen und Überzeugungen teilen. Man werde ermutigt, Elemente der eigenen Lebensgeschichte oder -situation beizusteuern, die für das eigene Leiden womöglich relevant sind, und die Verbindungen zwischen Verlust oder Angst und Schmerz auszuloten. Bleibt in der traditionellen Medizin mehr Menschen das erspart, was Arthur W. Frank in seinem Buch The Wounded Storyteller als „narrative Unterwerfung“ bezeichnet, diesen „zentralen Moment in der modernen Krankheitserfahrung“, fast schon „eine Verpflichtung aller, die medizinische Hilfe in Anspruch nehmen“?
Ein Medikament, das meine Großmutter, Mumji, täglich einnimmt, wurde verändert: Marke, Inhaltsstoffe, Herstellungsort – alles war gleich, nur das Design der Verpackung war neu. „Die Tabletten sind nicht mehr so gut wie früher“, beklagte sie sich ein paar Tage später. „Ich fühle mich nicht wohl. Die nehme ich nicht mehr.“ Die Ärztin versicherte, das Produkt sei identisch, und riet ihr, es weiter einzunehmen, da es ihr sonst bald schlechter ginge. Sie war nicht überzeugt und beschwerte sich beim Apotheker, ihrem langjährigen Hauslieferanten für Tabletten und Tinkturen. Er brachte ihr beide Versionen des Medikaments mit, wies sie auf jeden Punkt hin, in dem sie gleich waren, und erläuterte, die Neugestaltung der Verpackung sei ein Zeichen von Erfolg. Dann verriet er ihr den Preis, den sie pro Tablette zahlen müsste, wäre da nicht der britische Nationale Gesundheitsdienst. Es sei ein sehr teures, beliebtes Medikament, sagte der Apotheker, aber wenn sie nicht zufrieden sei, könne er sich selbstverständlich nach einer Alternative umsehen. Nicht nötig, sagte Mumji, sie würde das Medikament weiter einnehmen. „Mir ging’s nie besser“, berichtete sie ein paar Wochen später.
Obwohl die Mehrheit der Afrikaner und Afrikanerinnen der traditionellen Medizin vertraut, ist sie in vielen afrikanischen Ländern noch immer illegal. 2012 änderte Kenia das aus der Kolonialzeit stammende Hexereigesetz, das die Heilkunst seit 1925 verboten hatte; das Gesetz bestraft nun nur noch diejenigen, die Hexerei „in schädlicher Absicht“ praktizieren; darauf stehen bis zu fünf Jahre Gefängnis. Eine zusätzliche Klausel stellt die Anschuldigung, jemand sei eine Hexe oder praktiziere Hexerei, unter Strafe. Mit dem Erlass dieser Änderungen wurde auf Berichte über Angriffe auf Älteste oder deren Ermordung durch ihre erwachsenen Kinder reagiert.
Das war die Bedrohung, die Mwarandu gemeint hatte.
Die Gewalt wird mit Hexerei begründet, doch die wahre Motivation ist das Land; die jungen Leute, die nicht mehr die Überzeugung ihrer Ältesten teilen, dass das Land für die künftige, gemeinsame Nutzung erhalten werden müsse, wissen, dass sie nach dem Tod der Eltern die Landrechte erben – und die Möglichkeit, Land zu verkaufen. Und so planen manche die Ermordung der eigenen Eltern. In der Küstenregion kam es besonders häufig zu Angriffen dieser Art; jüngste Zählungen gehen von rund 400 Fällen pro Jahr aus. Das Rettungszentrum in Malindi wurde eingerichtet, um Giryama-Ältesten zu helfen, die von ihren Kindern bedroht oder attackiert wurden.
Ich musste an Mumji denken, Mitte 90, allein in einem zweistöckigen Haus mit drei Schlafzimmern. Als mein Großvater vor rund zehn Jahren starb, hatte er seine Hälfte des Hauses seinen Kindern vermacht. Es hatte mal einen Moment gegeben, in dem ich wünschte, Mumji – einen Moment, in dem ich darüber nachdachte, wie anders das Leben meiner Mutter sein könnte, wenn – Gedanken, die wieder verscheucht wurden, sobald sie auftauchten – die trotzdem wieder auftauchten - begraben - die niemals - nie und nimmer …
Diese Verzweiflung – keine Chance nichts auf gar keinen Fall – wacha – festgefahren – Kohlehimmel – Momente häufen sich an, ergeben keinen Sinn – Flammen ohne Brennstoff – was Gedanken zu Taten kippen lässt – trübe Tage – Zeit ohne das Gewicht von Verheißung – nein und nein und nein und Not – welche Rechtfertigung – DIE HÖLLE, DAS SIND DIE ANDEREN – ein Moment, um alle Momente zu beenden – mit dem Beenden anfangen – Stunden dick wie Rauch – nie nie wieder – welches Streichholz entfacht Hoffnung und verbrennt die Zukunft, für immer.
Msongo wa mawazo, „rasende Gedanken“, ist ein Ausdruck für Depression auf tansanischem Kiswahili, den Mary Bitta für ihre Arbeit übernommen hat. Zur Beschäftigung mit psychischer Gesundheit gehört es, eine Sprache zu finden, die Menschen berührt, sie für eine Behandlung empfänglich macht. Manchmal aber, stellt Bitta fest, sind Worte nutzlos – etwa wenn die Leute sagen: „Das ist keine Depression, wir sind einfach nur pleite.“ Lassen sich Ursachen, Wirkungen und Folgen trennen?
Ein Manko des westlichen biomedizinischen Konzepts von „psychischer Gesundheit“ ist die Tendenz, sich auf das Individuum, die Biochemie zu konzentrieren. Die traditionelle Medizin scheint den Blick weiter zu spannen – eine Betrachtungsweise, von der sich viel lernen ließe.
Was, wenn wir von „elementarer Gesundheit“ sprächen – und neben den Informationen, die üblicherweise für die „Geschichte“ eines Patienten, einer Patientin zusammengetragen werden, auch andere Elemente miteinbeziehen würden, die Geist und Körper beeinflussen: soziale, ökonomische, umweltbedingte, ethnische, sexuelle? Was, wenn wir von „fundamentaler Gesundheit“ sprächen – und das verwurzelte Wesen des Ich, Beziehungen und Gemeinschaft als grundlegend für individuelles Wohlbefinden anerkennen würden? Könnten Begriffe wie diese die biomedizinische Vorstellungskraft nach und nach erweitern, den Rahmen dessen verschieben, was die wirksamste Medizin auszeichnet?
„Das Land zu verkaufen, ist nicht die Lösung“, überlegte Munyaya. „Die Jungs verprassen das Geld für ein Motorrad und leben ein paar Monate auf großem Fuß. Dann haben sie kein Geld, kein Land und keine Eltern mehr. Kein Wunder, dass Depression und Suizid so verbreitet sind.“
Die Ältesten sitzen da, als hätten sie die Zeit auf ihrer Seite. Die Streifen aus Raffiabast, die sie zu Körben flechten, trotzen den Minuten, erzählen raschelnd von unzähligen Händen, die genau das seit Jahrhunderten getan haben: sich im Einklang bewegen, die Natur zu Formen flechten, die das Grundlegende, das Wesentliche und vielleicht auch das Unwesentliche bewahren. Die Ältesten sprechen kaum Englisch, leisten uns aber großzügig Gesellschaft. Sie strahlen etwas aus, das sich wie unendliche Geduld anfühlt. Ruhe zu bewahren, während man versucht, eine Lösung zu finden. Ich spüre, wie eilig ich es hatte, „auf den Punkt zu kommen“, was auch immer der sein mochte; irgendeine tiefe Einsicht, ein Heilmittel, das mein Leben verändert, eine Tatsache, die mein Bewusstsein umkrempelt. Wo mögen die wohl liegen? Irgendwo jenseits des Kolonialismus? Meine Fragen klingen, als gäbe es einen solchen Ort. Als könnte ich ihn erreichen. Als könnte ich eine Stecknadel in die weitläufigen Areale des Wissens pinnen und mich oder andere daran orientieren.
Erst jetzt, Monate nach der Reise, habe ich doch noch eine Antwort auf Esther Kambas Bemerkung. Selbst wenn ich es versuchte, könnte ich die Spiritualität nicht „nehmen“. Wie viel Verortung - Tradition - Beziehung steckt in der Medizin? Wie viel Glaube an ein bestimmtes System steckt in der Heilung? Was sich nicht messen lässt, kann auch nicht genommen werden. Und doch birgt jede Begegnung, jede Frage etwas Wertvolles.
Der Mkone treibt vom Fuß des Hauptstamms aus Äste: Statt eines einzigen Baumes, der aus dem Boden emporsteigt, sieht er aus wie ein Bündel vieler Bäume, die gemeinsam miteinander wachsen.
Aus dem Englischen von Beatrice Faßbender