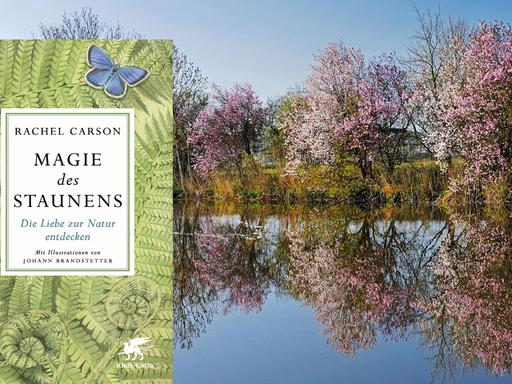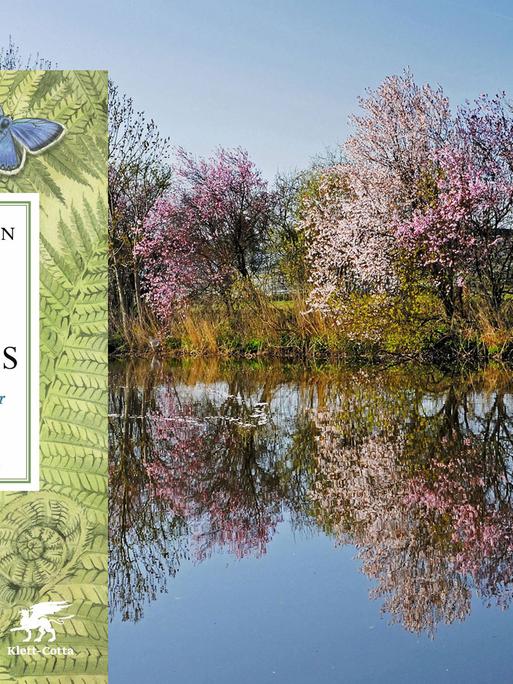Spätestens seit der Debatte um das Anthropozän bewegt der menschliche Einfluss auf den Zustand der Weltmeere die Naturwissenschaften. Plastifizierung, Klimawandel, Schmelzen der Polarkappen und der Rückgang wichtiger mariner Arten fließen in naturwissenschaftliche Datenaufnahmen und daran anknüpfende Appelle zum Meeresschutz ein. Weniger bekannt ist, dass sich in jüngster Zeit auch die Sozial- und Kulturwissenschaften eingehender mit dem Meer befassen. Unter dem Sammelbegriff der „Marine Social Sciences“ untersuchen sie gesellschaftliche Aspekte von Meer-Mensch-Beziehungen. Und so brechen Soziologinnen und Kulturwissenschaftler in Friesennerz und Gummistiefeln zu Meeresfahrten auf, angetrieben von der Vision einer „Soziologie des Meeres“ im Zeitalter des Anthropozäns.
Dass nach Tanja Bogusz die Meeresschnecke Joculator boguszae benannt worden ist, zeigt unmittelbar, wie intensiv die Meeressoziologin Feldforschung betreibt. Denn Bogusz begleitete etwa Taxonomen des Pariser Naturkundemuseums 2012 auf einer meeresbiologischen Expedition nach Papua-Neuguinea. Bogusz forscht am Zentrum für nachhaltige Gesellschaftsforschung der Universität Hamburg im Projekt „Natur und Gesellschaft erfahren. Eine standortübergreifende Untersuchung der marinen und ethnographischen Feldforschung“.
Der Erfolg, den die US-amerikanische Meeresbiologin Rachel Carson 1951 mit ihrem Buch The Sea Around Us hatte, war überraschend. Schließlich gab es noch keine globale Umweltschutzbewegung. Dennoch stand das Werk jahrelang auf Bestsellerlisten, wurde mehrfach ausgezeichnet und intensiv diskutiert. „Es ist eine seltsame Situation“, schrieb Carson damals, „dass das Meer, aus dem das Leben entstanden ist, nun durch die Aktivitäten einer Form dieses Lebens bedroht ist. Doch das Meer wird, obwohl es sich auf unheilvolle Weise verändert hat, weiter existieren; die Bedrohung betrifft vielmehr das Leben selbst.“ Die Autorin traf offenbar nicht nur den Nerv der Zeit, sondern behandelte auch einen Gegenstand von besonderem Interesse. Carson, die dann 1962 mit ihrem Buch Der stumme Frühling das Ende des Einsatzes von Pestiziden in der US-amerikanischen Landwirtschaft einläutete und sich zeitlebens für den Umweltschutz einsetzte, sensibilisierte mit The Sea Around Us zahlreiche Leserinnen und Leser für die Bedeutung des Meeres. Als Meeresforscherin und Schriftstellerin machte sie die komplexe Beziehung zwischen Meer, Wissenschaft und Gesellschaft anschaulich. Heute steht diese Beziehung im Mittelpunkt einer noch jungen Disziplin: der Soziologie des Meeres.
Warum aber sollte sich ausgerechnet die Soziologie mit dem Meer beschäftigen? Ist das Meer als Teilbereich der Natur nicht die Domäne der Naturwissenschaften? Und ist die Soziologie nicht die Wissenschaft vom Menschen als Sozius, als soziales Wesen, und liegt damit im Gegenstandsbereich der Sozialwissenschaften? Solche und ähnliche Fragen kommen auf, wenn die Rede von der Soziologie des Meeres ist. Als „moderne Wesen“ im Sinne Bruno Latours und Philippe Descolas sind wir es immer noch gewohnt, Natur und Gesellschaft trotz ihrer unübersehbaren Verflechtung voneinander zu trennen. Universitäten teilen ihre Fakultäten entlang dieser ontologischen Unterscheidung auf und akademische Abschlüsse werden nach wie vor fein säuberlich voneinander getrennt: hier „die Natur“ – dort „die Gesellschaft“.
Abhängigkeit des Menschen vom Meer
Über 70 Jahre sind seit Erscheinen von Carsons Bestseller vergangen. Ihr Plädoyer, die Abhängigkeit des Menschen vom Meer nicht zu unterschätzen, hat an Aktualität nichts eingebüßt. Und doch ist vieles anders. Mit dem Zeitalter des Anthropozän, von den Geologen Paul J. Crutzen und Eugene Stoermer als die Phase der Erdgeschichte definiert, in der eine einzige Spezies – der Mensch – zum entscheidenden Faktor für die Erdentwicklung geworden ist, erlebt das Meer eine fundamentale Transformation. Der Weltozean ist beeinflusst durch soziale und physikalische Prozesse, die einem permanenten Wandel unterliegen – an Land, auf dem Meer und an der Küste. Im Anthropozän stehen diese Prozesse in einer Interdependenz zueinander, in einer wechselseitigen und vielschichtigen Abhängigkeit. Selbst die entferntesten ozeanischen Ökosysteme sind heute vom Menschen beeinflusst, weil marine Nahrungsnetze und Strömungssysteme rund um unseren blauen Planeten miteinander verbunden sind.
Der Weltozean deckt 70 Prozent der Gesamtoberfläche der Erde ab. Er ist die Basis allen Lebens. Rund 50 Prozent des Sauerstoffs, den wir täglich einatmen, wird durch Phytoplankton im Meer produziert. Der Schutz der marinen Ökosysteme, welche die Reproduktion des Phytoplanktons sicherstellen, stellt damit eine direkte Voraussetzung für das Überleben aller planetaren Arten dar – inklusive des Menschen. Zugleich ist das Meer ein gigantischer Wirtschaftsraum: Über 90 Prozent des Welthandels werden über den Seeweg abgewickelt. Die meisten Güter, Kleidung, Nahrung und Technologien, die wir täglich nutzen, sind über das Meer zu uns gelangt. Entsprechend hoch ist die logistische Bedeutung des Meeres für das, was wir gemeinhin „Globalisierung“ nennen. Die damit einhergehende massive Verschmutzung und Plastifizierung der Meere führt zur Destabilisierung mariner Stoffkreisläufe und zur Auslöschung mariner Arten, Korallenriffe und Ökosysteme. Der durch den Klimawandel ausgelöste steigende Meeresspiegel droht nicht nur, Pazifikstaaten untergehen zu lassen. Auch Nordeuropa bereitet sich darauf vor. Die gefährdete Resilienz der Weltmeere mindert auch ihre zentrale Funktion als Kohlenstoffspeicher, der den menschengemachten CO2-Ausstoß bislang noch abmildern konnte.
Das Anthropozän beinhaltet, dass sich alle gesellschaftlichen Bereiche und damit auch die Soziologie mit den physischen Voraussetzungen des Lebens auf der Erde auseinandersetzen müssen. Die Trennung vom Meer als Teil der „Natur“ auf der einen, und „Gesellschaft“ auf der anderen Seite ist also faktisch längst aufgehoben. Darauf hatte bereits Ulrich Beck 1986 in seinem Klassiker Risikogesellschaft hingewiesen – ebenfalls ein Kassenschlager, vergleichbar dem Werk Carsons. Der Anlass für die erhöhte gesellschaftliche Sensibilisierung lag damals in der Reaktorkatastrophe im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl, die sich nur wenige Wochen vor dem Erscheinungstermin des bereits fertig geschriebenen Buches ereignete. Man könnte Tschernobyl als Beginn einer ganz spezifischen Zeitenwende bezeichnen, die in der Erkenntnis lag, dass Umwelt- und Technologiekatastrophen gesellschaftliche Fundamente auf eine Art bedrohen und außer Kraft setzen, die das moderne Ordnungsgefüge grundlegend in Frage stellt. Heute sind naturbasierte Katastrophen an der Tagesordnung – die gesellschaftlichen Konflikte um den Umgang mit den schrumpfenden natürlichen Ressourcen ebenso.
Geopolitischer Ressourcenkampf
Die Industrialisierung des Meeres hat in den vergangenen Jahren deutlich an Fahrt aufgenommen. Die Diskussion um die Wirksamkeit des 2023 verabschiedeten Hochseeabkommens gibt einen Vorgeschmack auf den geopolitischen Kampf um Meeresressourcen. Doch sind die Folgen des weiter voranschreitenden Tiefseebergbaus für marine Ökosysteme unabsehbar. Die Implementierung von Offshore-Windenergie, die seit dem Krieg in der Ukraine insbesondere in der Nordsee beschleunigt wurde, hat ein neues Narrativ gesetzt – das Meer als „Kraftwerk Europas“. Der Transformationsdruck auf die Weltmeere ist gewaltig. Wissenschaftlerinnen bezweifeln, dass gegenwärtige Schutzmaßnahmen ausreichen, diesen Transformationsdruck nachhaltig abzufedern. Bereits jetzt lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung am Meer. Schätzungen zufolge werden es bis 2070 rund 70 Prozent sein.
Die Meer-Mensch-Beziehung hat also viele Gesichter. So grenzenlos wie das Meer, so unerschöpflich scheinen die Möglichkeiten, es zu reflektieren. Weitaus intensiver als die Soziologie befassten sich bislang die Geschichts- und Kulturwissenschaften mit dem Meer. Historisch galt es viele Jahrhunderte lang sowohl als Mysterium, wie auch als Feind des Menschen. Die biblische Vorstellung von der Sintflut gab der realen Gefahr des Meeres ein Bild, das sich für lange Zeit in die Kulturgeschichte des Westens einprägte. Und so entspannen sich viele Sagen und Mythen um das Meer, um den unerbittlichen „blanken Hans“ in Norddeutschland bis hin zu Annahmen über eine göttliche Rache, die in manchen Gegenden Südostasiens mit dem Aufkommen von Tsunamis verknüpft wurde.
Das Meer verbindet und trennt Staaten, geopolitische Räume und Kontinente. Es trägt maßgeblich zu ihrer politischen, rechtlichen und kulturellen Konstitution bei. Es ist Infrastruktur bei Flucht und Vertreibung und birgt Gefahr für Leib und Leben. Im Zuge der Kolonialisierung verwandelten sich Teile des Ozeans in einen „Black Atlantic“, der durch Paul Gilroys gleichnamiges Buch 1993 zum Synonym für die afrikanische Diaspora und globale Ungleichheiten wurde. Nicht zufällig kommt der Begriff der Expedition aus dem sprachlichen Arsenal militärischer Expansionspolitik, das ungebrochen in die Welt der Natur- und Meeresforschung übertragen wurde – wenn auch ein Alexander von Humboldt der Kolonialpolitik seiner Zeit ebenso kritisch gegenüberstand wie der noch gänzlich unbekannte 22jährige Charles Darwin. Darwin berichtete in Die Reise der Beagle 1831 von seiner ersten großen Forschungsreise. Bei einem Landgang am brasilianischen Rio Macaé zeigte er sich entsetzt über den menschenverachtenden Sklavenhandel.
Vor der auch durch Humboldt und Darwin beförderten Deutungshoheit der Naturwissenschaften hatte das Abendland die Küste bereits als faszinierenden Lebensraum entdeckt, in dem Mensch und Natur aufeinandertrafen. So schreibt der französische Kulturhistoriker Alain Corbin über das 18. Jahrhundert als eine Phase, in der das Meer zugleich als Ort der Erholung und Kontemplation wie auch als unerschöpfliche Quelle spannender Entdeckungen galt. Heute, im Angesicht der planetarischen Krise der Ozeane, wird diese Verbindung wieder spürbar. Die menschliche Begeisterung für das Meer scheint zeit- und grenzenlos.
Küstenregionen sind bedeutende Erholungsräume. Sie gehören zu den weltweit am schnellsten wachsenden Tourismussektoren. Zugleich verleiht der dringende Bedarf nach Meeresschutz dem Meer einen herausragenden Status unter den globalen Kulturgütern. So wurde das Wattenmeer, das die Niederlande, Deutschland und Dänemark verbindet, aufgrund seiner einzigartigen biologischen, geologischen und ökologischen Zusammensetzung 2009 zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt. Das ist nicht gleichbedeutend mit einem Naturschutzgebiet, erhöht aber seinen ethischen Wert und trägt zum Erhalt dieser einmaligen Küstenregion bei.
Zielkonflikt zwischen ökologischen und ökonomischen Interessen
Doch als im Sommer 2023 das Containerschiff Fremantle Highway vor der niederländischen Küste brannte, 22 Besatzungsmitglieder verletzt wurden, ein Besatzungsmitglied starb und das Schiff beinahe havarierte, war dieses Weltnaturerbe gefährdet. Das alarmierte nicht nur Meeresbiologen. Tagelang bangte die Öffentlichkeit – eine Havarie hätte verheerende Umweltfolgen nicht nur für die lokale Region, sondern weltweit gehabt, da das Wattenmeer eine bedeutende Brutstätte für Zugvögel ist. Der Zielkonflikt zwischen ökologischen und ökonomischen Interessen war diesmal nicht eskaliert, doch es fehlte nicht viel. An den Schifffahrtswegen unweit der Wattenmeerküste wird trotzdem festgehalten.
Aber das Jahr 2023 war auch in anderer Hinsicht symptomatisch für sozio-marine Konflikte, wie sie typisch für das Anthropozän sind. Im Frühjahr 2023 erließ die EU eine neue Verordnung zum Schutz von Meeresgebieten, in denen fortan die Fischerei verboten werden sollte. Anlass war die rapide Dezimierung von Schweinswalen, Delphinen und Seevögeln sowie die Gefährdung von Riffen und Sandbänken. In Schleswig-Holstein war vor allem die Krabbenfischerei von dem Verbot betroffen. In Büsum und anderen Orten protestierten die Fischer lautstark gegen das Verbot. Nahezu zeitgleich organisierten Fischereiorganisationen in Frankreich die Kampagne „Filière morte“ – „Totes Netz“ gegen die Einrichtung von Meeresschutzzonen an der Atlantikküste. Zahlreiche Bundesstraßen wurden blockiert. Sogar das Gebäude des staatlichen Büros für den Schutz der Biodiversität in Brest wurde – wenn wohl auch versehentlich – in Brand gesetzt.*
Während Regierungen und Umweltschutzorganisationen die neuen Verordnungen begrüßten, beklagten die Fischer, dass sie selbst bereits viel zu einer ökologisch nachhaltigen Transformation des Sektors beigetragen haben. Die Schutzverordnungen würden einfach von oben nach unten durchgedrückt, ohne das langfristige wirtschaftliche Überleben der Fischer zu sichern. Ähnlich wie bei den Bauernprotesten witterten Populisten Morgenluft und suchten die Empörung für sich zu instrumentalisieren. Was fehlte, war eine professionelle Unterstützung der von der Transformation betroffenen Bereiche. Denn einerseits kann Überfischung zur Auslöschung mariner Arten im großen Stil führen. Doch andererseits gehört der Fischereisektor nach wie vor zu einer wichtigen Einkommensquelle für zahlreiche Küstengesellschaften.
An diesen Spannungsfeldern wird deutlich, dass das Zeitalter des Anthropozäns vor allem von einer Erkenntnis geprägt ist: Die Natur, und damit auch das Meer, ist von einer Ressource zu einem gesellschaftlichen Problem geworden. Analystinnen meinen, dass globale Verteilungskonflikte längst nicht mehr nur politisch begründet sind, sondern von den schwindenden natürlichen Ressourcen ausgehen, die der Menschheit noch zur Verfügung stehen. Die ökologische Gefährdung der Weltmeere wird damit zu einer Gefährdung ganzer gesellschaftlicher Existenzen. Diese Entwicklung eskaliert zunehmend in sozio-ökologischen Polarisierungen, in denen wirtschaftliche Interessen auf der einen ökologischen Notwendigkeiten auf der anderen Seite unversöhnlich gegenüberstehen.
Der Soziologe Steffen Mau spricht angesichts der gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Umbrüche und der polarisierten Debattenkultur von „Veränderungserschöpfung“. Er sieht in den sozialökologischen Zielkonflikten das Potenzial für einen „Mega-Konflikt“. Die Fischereiproteste zeigen in der Tat, dass der gesellschaftliche Umgang mit der Natur – und damit auch mit dem Meer – zu einer zentralen Frage für den sozialen Zusammenhalt geworden ist. Was können die Wissenschaften und insbesondere die Soziologie tun, um diesen Konflikt zu entschärfen?
2015 haben die Vereinten Nationen mit der Agenda 2030 vereinbart, 17 Nachhaltigkeitsziele zu definieren, deren Einhaltung die sozialökologische Zukunftsfähigkeit der Weltgesellschaft sichern soll. Das Nachhaltigkeitsziel Nr. 14 – „Leben unter Wasser“ richtete die Aufmerksamkeit auf den Meeresschutz und dessen wissenschaftliche Begleitung. Mit der sechs Jahre später ausgerufenen globalen Kampagne für Meeresforschung für nachhaltige Entwicklung 2021-2030, kurz „Ozeandekade“, hat die UN dieses Nachhaltigkeitsziel ausgebaut und konkretisiert. Neben ökonomischen, kulturellen, ökologischen und politischen Anstrengungen zur Erreichung dieses Ziels wird auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Natur- und Sozialwissenschaften explizit gesucht und gefördert. Auf der wissenschaftspolitischen Ebene bezeugt das eine nie dagewesene disziplinäre Öffnung der natur- und technikwissenschaftlich dominierten Meeresforschung. Diese Öffnung vollzieht sich parallel zur organisatorischen Etablierung der sozial- und kulturwissenschaftlichen Meeresforschung an Universitäten und Forschungseinrichtungen weltweit.
Seit Mitte der 2010er-Jahre haben sich internationale Vertreter aus den Politikwissenschaften, der Ökonomie, Humangeografie, Ethnologie, Anthropologie, Geschichts- und Kulturwissenschaften und der Soziologie unter dem Dach der „Marine Social Sciences" versammelt. Durch Publikationen, Manifeste, künstlerische Produktionen und Interventionen, Lektüregruppen und gemeinsame Veranstaltungen reflektieren sie Anpassungsbedarfe und Wechselwirkungen zwischen Meer und Gesellschaft. Im Konsortium Deutsche Meeresforschung, das alle großen deutschen Meeresforschungsinstitute versammelt, wurde 2017 eine Strategiegruppe „Marine Sozial- und Kulturwissenschaften“ etabliert. Sie befasst sich mit den gesellschaftlichen Folgen des marinen Biodiversitätsverlustes, der Wirkungen des Klimawandels auf Küsten und Meere, dem Ansatz einer „Blue Economy“ für die Weltwirtschaft, internationaler Meerespolitik sowie der inter- und transdisziplinären Meereszusammenarbeit. Innerhalb des „Zukunftsforum Ozean“, einer Art Think-Tank der deutschen Meeresforschung, wurde vor Kurzem das Arbeitsfeld „InTraOcean“ aufgelegt, das diese Zusammenarbeit nunmehr praxistauglich machen will. Klar ist: Die Verbindung zwischen Meer und Gesellschaft ist zu komplex, um allein den Naturwissenschaften und der Politik überantwortet zu werden. Und hier kommt die – noch im Entstehen begriffene – Soziologie des Meeres ins Spiel.
Ihr spezifischer Beitrag erschließt sich allerdings nicht direkt, sondern über Umwege. Denn trotz der faktischen Verschränkung von Meer und Gesellschaft blieb das Meer in der Soziologie lange Zeit relativ unbeachtet. Bekannt sind bis dato vor allem zwei im engeren Sinne soziologische Studien mit Bezug zur Seefahrt: Ferdinand Tönnies‘ Schriften zum Hamburger Hafenarbeiterstreik von 1896 und Norbert Elias‘ Studie zur Genese des marinen Offiziersberufes in Großbritannien, die er 1950 im Londoner Exil veröffentlichte. Berufe mit Meeresbezug gehören auch heute noch durch den maritim strukturierten Welthandel und die Industrialisierung der Meere zu den global weitverbreiteten Tätigkeiten. Sie werden mit dem Anstieg der Küstenbevölkerung und des küstenbezogenen Tourismus weiter an Bedeutung gewinnen.
Doch kann sich die Soziologie des Meeres heute nicht mehr auf die maritime Berufswelt beschränken. Vielmehr sind Meer und Gesellschaft auf eine Weise miteinander verbunden, die eine weitaus grundlegendere Reflexion erfordert. Ihre Interdependenz lässt eine scharfe Trennung kaum mehr zu. Meer und Gesellschaft befinden sich zudem in einem Verflechtungszusammenhang mit wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Globale ökonomische und geostrategische Dynamiken sind auf das engste mit dem Zugang zu Seewegen und Schifffahrtsrouten verknüpft. Die Konzepte der „Interdependenz“ und der „Verflechtungszusammenhänge“ stammen ebenfalls aus dem soziologischen Begriffsapparat von Norbert Elias. Seine an der Realität von dynamischen Veränderungen orientierte Soziologie lässt sich kongenial auf gegenwärtige Beobachtungen zur Verschränkung von Meer, Wissenschaft und Gesellschaft übertragen. Denn die sozio-marinen Interdependenzen gewinnen angesichts der unübersehbaren Wechselwirkungen zwischen menschlichen Aktivitäten und dem Zustand der Meere neue Plausibilität.
Die Herausforderungen für eine bessere analytische und forschungspraktische Integration von gesellschafts- und naturwissenschaftlicher Expertise sind riesig. Hatte die Soziologie das Meer lange nicht im Blick, so offenbart sich an den Beispielen der Beinahe-Havarie vor dem Wattenmeer und den Konflikten zwischen Meeresschutz und Fischerei eine grundlegend soziologische Fragestellung: Wie können Meer-Mensch-Beziehungen angesichts des gesellschaftlichen Anpassungsbedarfes an die ökologische Krise sozial nachhaltig organisiert und gestaltet werden? Eine Antwort darauf lautet, dass der Konflikt zwischen sozialen, ökologischen und ökonomischen Bedarfen über „heterogene Kooperationen“ eingefangen werden kann. Dabei geht es um Formen der Zusammenarbeit, bei denen Akteure unterschiedlicher Sozialisation, Profession und kultureller Prägung aufeinandertreffen. Genau das fehlt in einer Zeit, in der die Veränderungserschöpfung, von der Mau spricht, auch deshalb schnell zu antagonistischen Einstellungen führt, weil die soziale Spaltung nicht nur wirtschaftliche und bildungsspezifische, sondern auch erfahrungs- und lebensweltliche Trennlinien gezogen hat. Deshalb sind drei Themen für die soziologische Meeresforschung und damit für die Aufklärung des Verhältnisses von Mensch und Meer zentral: Wissen, Kooperation und Transformation.
Das Wissen, die Erfahrungen und die Kompetenzen von Küstenbewohnern, Beschäftigten im maritimen Sektor, in der Fischerei, im Küstenschutz, in Umweltschutzorganisationen und aus der Wissenschaft sind wertvolle Ressourcen für die Transformation der Meer-Mensch-Beziehung im Anthropozän. Sie systematisch zu erheben ist eine wichtige Voraussetzung dafür, die verschiedenen und häufig konfligierenden Bedarfe rund um das Meer einzufangen und zueinander in Beziehung setzen zu können. Drei marine Wissensformen sind hierbei relevant: Professionelles Wissen, wie es beispielsweise durch maritime Berufe (Fischerei, Werftarbeit, Seefahrt) angeeignet wurde, wissenschaftliche Erkenntnisse und marines Erfahrungs- und Alltagswissen, das sich durch das Leben am Meer häufig implizit in Küstenbevölkerungen wiederfindet und spezifische Kompetenzen im Umgang mit dem Meer erfordert. Ein soziologisch geschultes Verständnis über diese Wissensformen ermöglicht, die Auswirkungen der Krise der Ozeane für spezifische gesellschaftliche Bereiche besser zu verstehen. Erst, wenn darüber valide Erkenntnisse gewonnen sind, können bereits existierende, sowie potenzielle Zielkonflikte umfassend verstanden und bearbeitet werden. Es geht also um die Einbindung unterschiedlicher Wissensbestände, bevor politische Regelungen die oben angesprochenen Frontstellungen eskalieren lassen.
Ausgehend von der Verflechtung mariner Akteure mit Klimawandel und Biodiversitätsverlust stellt sich daran anknüpfend die Frage, wie ihre spezifischen Wissenskompetenzen sinnvoll genutzt und integriert werden können. Denn obwohl die Zusammenarbeit zwischen Akteuren verschiedener mariner Sektoren trotz sozialer Spaltungen gerade regional alltäglich sind, wurde sie häufig übersehen. Dabei zeigen Studien, dass genau diese Zusammenarbeit zwischen Fischern, Wissenschaftlerinnen und dem Küstenschutz – mit anderen Worten heterogene Kooperationen – insbesondere auf lokaler Ebene hervorragend funktionieren. Dazu gehören gemeinsame Untersuchungen von Fischern und Meereswissenschaftlern, die sich mit dem Aufkommen eines neuen Phänomens – wie zum Beispiel die Einwanderung neuer Meeresarten – und seiner Folgen für ein lokales Ökosystem auseinandersetzen. Aber auch die gemeinsame Nutzung mariner Infrastrukturen durch Wissenschaftlerinnen, Fischer und Küstenbewohner bieten sinnvolle Untersuchungsfelder, zum Beispiel wenn der Küstenschutz, der sich häufig aus ehemaligen Seeleuten rekrutiert, der Wissenschaft Boote und Teams für Wasserqualitätsmessungsexkursionen zur Verfügung stellt – selbstverständlich gegen angemessene Bezahlung. Denn die Seeleute verfügen über wertvolles Erfahrungswissen hinsichtlich spezifischer Meereszonen, das der Forschung hilft. Solche heterogenen Kooperationen bilden einen wichtigen Kitt für den alltäglichen Zusammenhalt mariner Küstengesellschaften.
Hinsichtlich der öffentlichen Sensibilisierung für die Belange des Meeres durch partizipative Forschungsformate scheint die vielbeschworene „Bürgerwissenschaft“ hingegen vor allem die ohnehin schon vom Meeresschutz Überzeugten abzuholen und schafft es doch kaum, in breitere Schichten und Milieus vorzudringen. Angesichts zunehmender gesellschaftspolitischer Polarisierungen stellt sich daher die Frage, wie soziale Gruppen jenseits des bildungsbürgerlichen Spektrums nachhaltige marine Aktivitäten wahrnehmen und umsetzen.
Solche heterogenen Kooperationen können ganz gezielt organisiert werden, indem unterschiedliche Akteure an der Entwicklung geteilter Zielvorstellungen für eine nachhaltige Meeresnutzung beteiligt werden. Das klingt einfach, aber wie immer ist der Ruf nach Partizipation dann schwierig, wenn es nicht nur um symbolische, sondern um echte Beteiligung geht. Ein solches Projekt wurde 2023 von Soziologen an den Thünen Instituten, eine Bundeseinrichtung für Agrar-, Forst- und Fischereipolitik, für die Nord- und Ostsee realisiert. Dabei diskutierte man folgende Fragen: Wie kann Meeresschutz mit dem Bedarf nach einem nachhaltigen Erhalt des Fischereigewerbes verknüpft werden? Wie lassen sich alternative Berufsfelder entwickeln, bei der die marine Expertise, welche die Fischer über viele Jahrhunderte aufgebaut haben, in eine sinnvolle Tätigkeit übersetzt werden kann, ohne dass sie an Einkommen und Ansehen verlieren?
Eins scheint sicher: Die Beziehung zwischen Mensch und Meer bleibt ambivalent. Sie umfasst ein schillerndes Spektrum, das sich zwischen Faszination, Ausbeutung, Zerstörung und Wertschätzung aufspannt. Und weil, wie der britische Soziologe Anthony Giddens einmal sagte, die Soziologie die Transformationswissenschaft par excellence ist, ist es die Soziologie, die Veränderungsprozesse beschreiben und dadurch wohl auch mitgestalten kann. Will sie nämlich nicht nur Beobachterin und Kommentatorin sozio-mariner Entwicklungen bleiben, müssen die realen Veränderungen nicht nur auf dem Schreibtisch, sondern in der maritimen Wirklichkeit inspiziert werden. Und so werfen sich Soziologinnen den Friesennerz über, ziehen Gummistiefel an und fahren aufs Meer. Sie begleiten Meeresforscherinnen auf Exkursionen, Fischer bei ihren Fangfahrten und beobachten marine Zoologinnen bei ihrer Arbeit im Labor. Sie gehen in maritime Museen, führen Gespräche mit Angehörigen des Küstenschutzes, der lokalen Politik und Verwaltung und mit Forschungstauchern. Sie organisieren runde Tische mit Anglern, Küstenbewohnern, Umweltingenieurinnen und Fischereiexperten. Sie denken über heterogene Kooperationen zwischen Angehörigen unterschiedlicher mariner Sektoren nach, die den sozialen Zusammenhalt stärken und Zielkonflikte eindämmen helfen. Kurz: Sie beteiligen sich an der Entwicklung neuartiger Meer-Mensch-Beziehungen. Dabei geht es auch um das Verlassen der akademischen Komfortzone und ein Sich‑Einlassen auf schwankendes Terrain in unruhigen Zeiten.
Denn schließlich ist es, wie Rachel Carson auf eindrückliche Weise bezeugte, das Meer, das uns umgibt – und nicht umgekehrt. Während meiner Feldforschung in der französischen Bretagne im vergangenen Herbst bin ich oft zu einem bestimmten Uferabschnitt gegangen, um dort einem wunderbaren Schauspiel beizuwohnen. Eine Gruppe kleiner Sanderlinge traf sich dort immer auf einem Felsen. Diese Meeresvögel sind nicht viel größer als eine Kinderhand, haben weiße Bäuche, eine graubraun gefiederte Oberseite, schwarze Knopfaugen und feine schwarze Flossenfüßchen. Wenn die Flut kam, rannten sie flink vor den aufpeitschenden Wellen davon und flogen im letzten Moment hoch. Dabei fiepten sie laut und fröhlich. Sobald die Wellen sich zurückzogen, liefen sie ihnen draufgängerisch hinterher, so weit sie konnten. Biologen erklärten mir, dass die Flut den Meeresvögeln ganz bestimmte Nährstoffe bringt. So formen sie im Rhythmus der Wellen einen Tanz mit den Gezeiten.
Ich konnte mich daran nicht sattsehen. Die Tiere drückten eine faszinierende Freude und Leichtigkeit aus. Sie vermittelten eine Einsicht, die so grundlegend ist für das Anthropozän. Ihr scheinbar spielerisches Einlassen auf die Gesetze der Natur hat einen handfesten Grund: Es sichert ihr Überleben. Ihr Tanz mit den Wellen spiegelte einen Sinn für den beständigen Wandel des Lebens wieder, der nicht im Widerspruch stand zu ihren Grundbedürfnissen – im Gegenteil. Denn wie Carson schrieb: Anders als die Moderne uns Menschen Glauben machte, können wir das Meer zwar nutzen, doch beherrschen werden wir es niemals. Es ist diese Einsicht in unsere unabweisbare Abhängigkeit von der Natur, die das Meer und seine Bewohner uns lehren können – wenn wir es zulassen.
*Korrekturenhinweis: Das Gebäude des staatlichen Büros für den Schutz der Biodiversität befindet sich in Brest und nicht in Rennes. Diese Ortsangabe haben wir abgeändert.